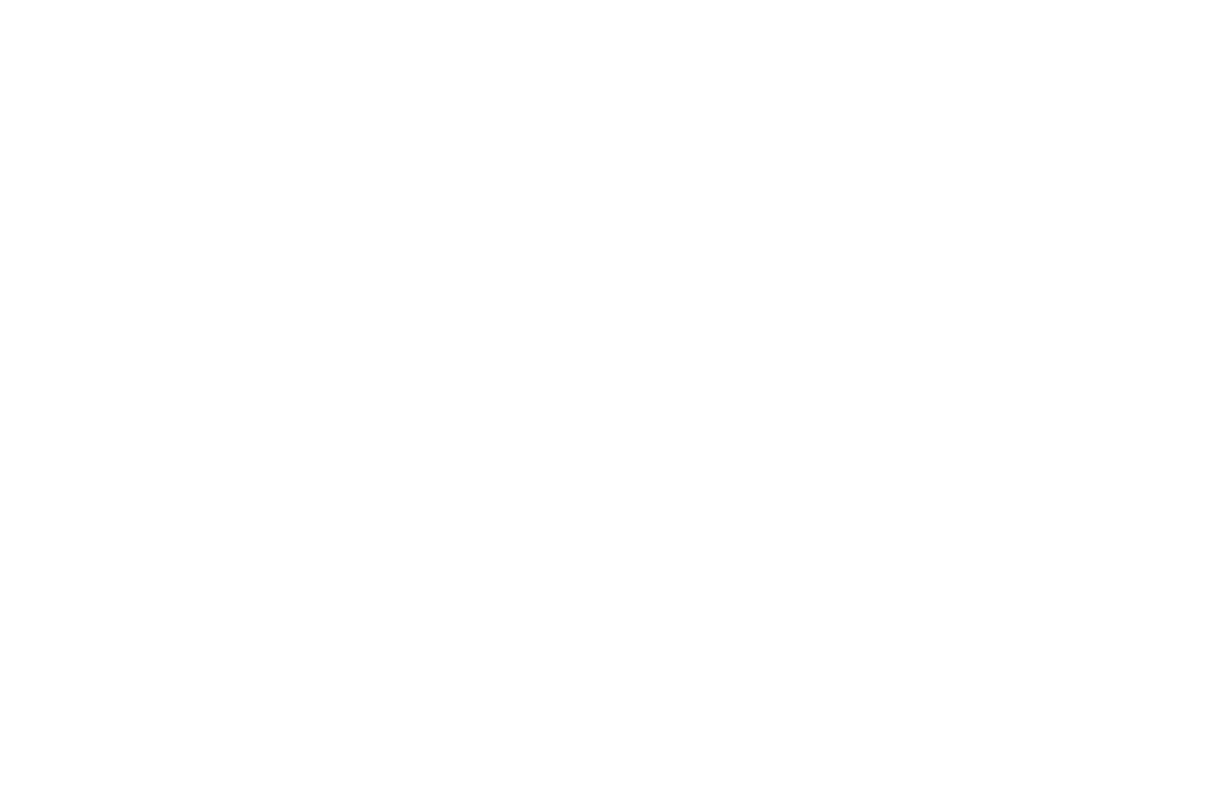Der Potsdamer Theaterpreis 2024 geht an Kristin Muthwill und Guido Lambrecht
Im Juli vergab der Förderkreis zum zweiten Mal in der Intendanz von Bettina Jahnke den Potsdamer Theaterpreis. Alle zwei Jahre werden damit eine Künstlerin und ein Künstler gewürdigt, „die in besonderer Weise zur Ausstrahlung des Hans Otto Theaters beigetragen haben“. Im Jahr 2022 zeichnete die Jury Nadine Nollau und Paul Wilms aus. In diesem Jahr fiel ihre Wahl auf Kristin Muthwill und Guido Lambrecht. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert, die sich die Preisträger*innen teilen.
Muthwill steche „durch herausragende Rollen-Interpretationen unterschiedlichster Charaktere und enorme spielerische Wandlungsfähigkeit“ hervor, heißt es in der Jury-Begründung. Das zeigte sie in zahlreichen Inszenierungen, unter anderem als Trude Grimm in „Wir sind auch nur ein Volk“ „mit subversivem Ostfrauen-Selbstbewusstsein und Sexappeal“ oder in „Antigone“ in der Gänsehaut-Doppelrolle als Iokaste und Teiresias.
Lambrecht besteche dadurch, dass er sich nicht festlegen lasse und „in den Abgründen die Komik bloßlegt und im Komischen den Abgrund“, so die Jury. Besonders hervorgestochen habe er in „Die schmutzigen Hände“ als Parteisekretär Hoederer und „Mephisto“ als Klaus Mann.
Der von der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestiftete Publikumspreis ging ebenfalls an „Mephisto“. Die Inszenierung von Sascha Havemann nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann wird regelmäßig mit tosendem Applaus honoriert.
Einen Sonderpreis erhielt das Ensemble von Sing ich dir, das regelmäßig mit fetzigen Wunschkonzerten für ausverkaufte Säle sorgt. Initiiert hat das Projekt Mascha Schneider, die gemeinsam mit Jan Hallmann, Laura Maria Hänsel, Janine Kreß, Charlott Lehmann, Arne Lenk, Philipp Mauritz, Nadine Nollau, Hannes Schumacher und Paul Sies musiziert und singt.
Muthwill steche „durch herausragende Rollen-Interpretationen unterschiedlichster Charaktere und enorme spielerische Wandlungsfähigkeit“ hervor, heißt es in der Jury-Begründung. Das zeigte sie in zahlreichen Inszenierungen, unter anderem als Trude Grimm in „Wir sind auch nur ein Volk“ „mit subversivem Ostfrauen-Selbstbewusstsein und Sexappeal“ oder in „Antigone“ in der Gänsehaut-Doppelrolle als Iokaste und Teiresias.
Lambrecht besteche dadurch, dass er sich nicht festlegen lasse und „in den Abgründen die Komik bloßlegt und im Komischen den Abgrund“, so die Jury. Besonders hervorgestochen habe er in „Die schmutzigen Hände“ als Parteisekretär Hoederer und „Mephisto“ als Klaus Mann.
Der von der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestiftete Publikumspreis ging ebenfalls an „Mephisto“. Die Inszenierung von Sascha Havemann nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann wird regelmäßig mit tosendem Applaus honoriert.
Einen Sonderpreis erhielt das Ensemble von Sing ich dir, das regelmäßig mit fetzigen Wunschkonzerten für ausverkaufte Säle sorgt. Initiiert hat das Projekt Mascha Schneider, die gemeinsam mit Jan Hallmann, Laura Maria Hänsel, Janine Kreß, Charlott Lehmann, Arne Lenk, Philipp Mauritz, Nadine Nollau, Hannes Schumacher und Paul Sies musiziert und singt.
LAUDATIO AUF KRISTIN MUTHWILL
LAUDATIO AUF KRISTIN MUTHWILL
von Petra Bläss
Wir ehren heute eine Schauspielerin, die die Kunst der Verwandlung auf ganz besondere Weise beherrscht - durch herausragende Rollen-Interpretationen unterschiedlichster Charaktere und enorme spielerische Wandlungsfähigkeit. Der Potsdamer Theaterpreis 2024 geht an Kristin Muthwill.
Die Jury befand, dass die Intensität und die Präzision ihrer Rollen-Darstellungen maßgeblich zum Erfolg von Inszenierungen des Hans Otto Theaters beigetragen haben. Unvergessen bleiben aus früheren Spielzeiten u.a. ihre Elisabeth in „Maria Stuart“ im berührenden Zusammenspiel mit Janine Kress, ihre Nora in „Vögel“ und ihr Fräulein Schneider in „Cabaret“. Von ihrer Trude Grimm in „Wir sind auch nur ein Volk“ mit schön subversivem Ostfrauen-Selbstbewusstsein und Sexappeal ist bestimmt nicht nur mir der Abschied besonders schwergefallen. Das Publikum hatte sie und ihren kongenialen Bühnenpartner Jon-Kaare Koppe als Benno Grimm sofort ins Herz geschlossen. Die Grimms waren einfach ein Bühnen-Traumpaar!
Leidenschaft und Verletztheit hat sie eindrücklich als Jelena in „Kinder der Sonne“ verkörpert. Als Iokaste in „Antigone“ sorgte sie durch ihre Darstellung der Zerrissenheit einer Mutter, die zwischen ihren beiden verfeindeten Söhnen steht, für Gänsehautmomente. Und es waren auch hier die ganz feinen Gesten, mit denen es ihr eindrucksvoll gelang, glaubwürdig die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld darzustellen. Schön zickig kam sie als Arsinoe im Schlosstheaterschen „Menschenfeind“ daher – mit einem wirklich meisterhaften Hinfaller.
Innerhalb eines Stückes gleich zwei Rollen meisterhaft zu beherrschen und sogar die Verwandlung im wahrsten Sinne des Wortes zu einem "Schau-Spiel" machen zu können, das hat Kristin Muthwill schon mehrfach mit Bravour bewiesen: als Christine und Fred in Konstanze Lauterbachs unvergesslicher „Brilka“- Inszenierung oder in den letzten beiden Sommertheater-Aufführungen - zum Einen als Frosina und Kommissarin in „Der Geizige“ und zum Anderen als herrschsüchtige Herzogin Frida und ihrer gütigen Schwester Ann in „Wie es euch gefällt“.
In „Antigone“ verwandelt sie sich als Iokaste auf offener Bühne gemeinsam mit Arne Lenk in den Seher Teiresias. Was für eine Herausforderung, dann einen solchen Text ineinander verschlungen auch noch versetzt gemeinsam zu sprechen – Chapeau!
Wir würdigen heute mit Kristin Muthwill auch eine begnadete Ensemblespielerin: Beste Beweise dafür sind wie sie gemeinsam mit Jörg Dathe, Mascha Schneider, Paul Willms, Arne Lenk und Alina Wolf / Franziska Melzer in „Antigone“ und mit Nadine Nollau, Franziska Melzer, Henning Strübbe, Philipp Mauritz, Hannes Schumacher und Arne Lenk in „Eure Paläste sind leer“ präzise die hohe Kunst des Sprechchors meistert.
Stichwort Ensemblekunst: Zusammen mit Franziska Melzer, Nadine Nollau, Laura-Maria Hänsel und Charlott Lehmann sorgte Kristin Muthwill für DEN Publikumsrenner der letzten zwei Spielzeiten mit verdienten Standing Ovations für eine exzellente Verkörperung von insgesamt 18 Rollen und meisterhaften Gesang: „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“. Schon das Tempo, mit dem unsere fünf genialen Mädels von einer Rolle in die andere schlüpfen, lässt einem den Atem stocken. Ich konnte mich jedenfalls auch beim 14. Mal nicht sattsehen und genug „Bravos“ rufen…
Unsere heutige Preisträgerin spielt ihre vier Rollen in „Stolz und Vorurteil“ - das Dienstmädchen Tilli, den verliebten Mr. Bingley, seine intrigante Schwester und die naive Charlotte Lukas - einfach sagenhaft. Der Szenenapplaus bei der Klo-Szene, in der sie zeitgleich Charlotte und Mr.Bingley spielt, war ihr immer sicher. Dieses kongeniale „Two in One“ hat zweifellos Maßstäbe gesetzt – sollte aber in Zeiten von Sparzwängen wohl besser nicht Schule machen.
Kristin Muthwill beherrscht ihr Handwerk exzellent – mit toller Bühnenpräsenz und markanter unverwechselbarer Stimme, die auch jede ihrer Lesungen zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis macht: Ob Stefan Zweigs „Briefe einer unbekannten Frau“, ob im Rahmen der „Märkischen Leselust“ - ganz besonders als sie die Texte von Regine Hildebrandt vortrug - oder im Rahmen der Solidaritätsabende für die Ukraine und Israel. Und sie war es, die im Audiowalk rund um das Große Haus „Auf den Spuren des Hans Otto Theaters“Selbigem ihre Stimme gegeben hat.
Dass sie noch ganz andere Register ziehen kann, hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt: mit ihrem wunderbaren Solo - „Max und Moritz“-Abend im Rahmen der damaligen „Nachtschwärmer“, in der Corona-Zeit gemeinsam mit Hennig Strübbe als köstliches Clowns-Duo (für mich bleiben sie die besten Quiz-Master ever!), als „Kleine Hexe“ im köstlichen Zusammenspiel mit Jörg Dathe bei den letzten „SchauSpielFenstern“ oder erst gestern im „Warten auf…“-Marathon von Jon-Karre Koppe und Henning Strübbe im RAhmen von "Inseln der Zukunft". Der improvisierte herrliche Erklärungsversuch des Stuttgarter Fußball-EM-Dramas vom Vortag war für mich der Höhepunkt der 3 ½ Stunden! Und so können wir uns schon auf die Geldhexe Tyrannja im diesjährigen Weihnachtsmärchen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ freuen.
Jetzt aber gratulieren wir Kristin Muthwill ganz herzlich zum Potsdamer Theaterpreis 2024 und lassen sie hier und heute angemessen hochleben und feiern!
Die Jury befand, dass die Intensität und die Präzision ihrer Rollen-Darstellungen maßgeblich zum Erfolg von Inszenierungen des Hans Otto Theaters beigetragen haben. Unvergessen bleiben aus früheren Spielzeiten u.a. ihre Elisabeth in „Maria Stuart“ im berührenden Zusammenspiel mit Janine Kress, ihre Nora in „Vögel“ und ihr Fräulein Schneider in „Cabaret“. Von ihrer Trude Grimm in „Wir sind auch nur ein Volk“ mit schön subversivem Ostfrauen-Selbstbewusstsein und Sexappeal ist bestimmt nicht nur mir der Abschied besonders schwergefallen. Das Publikum hatte sie und ihren kongenialen Bühnenpartner Jon-Kaare Koppe als Benno Grimm sofort ins Herz geschlossen. Die Grimms waren einfach ein Bühnen-Traumpaar!
Leidenschaft und Verletztheit hat sie eindrücklich als Jelena in „Kinder der Sonne“ verkörpert. Als Iokaste in „Antigone“ sorgte sie durch ihre Darstellung der Zerrissenheit einer Mutter, die zwischen ihren beiden verfeindeten Söhnen steht, für Gänsehautmomente. Und es waren auch hier die ganz feinen Gesten, mit denen es ihr eindrucksvoll gelang, glaubwürdig die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld darzustellen. Schön zickig kam sie als Arsinoe im Schlosstheaterschen „Menschenfeind“ daher – mit einem wirklich meisterhaften Hinfaller.
Innerhalb eines Stückes gleich zwei Rollen meisterhaft zu beherrschen und sogar die Verwandlung im wahrsten Sinne des Wortes zu einem "Schau-Spiel" machen zu können, das hat Kristin Muthwill schon mehrfach mit Bravour bewiesen: als Christine und Fred in Konstanze Lauterbachs unvergesslicher „Brilka“- Inszenierung oder in den letzten beiden Sommertheater-Aufführungen - zum Einen als Frosina und Kommissarin in „Der Geizige“ und zum Anderen als herrschsüchtige Herzogin Frida und ihrer gütigen Schwester Ann in „Wie es euch gefällt“.
In „Antigone“ verwandelt sie sich als Iokaste auf offener Bühne gemeinsam mit Arne Lenk in den Seher Teiresias. Was für eine Herausforderung, dann einen solchen Text ineinander verschlungen auch noch versetzt gemeinsam zu sprechen – Chapeau!
Wir würdigen heute mit Kristin Muthwill auch eine begnadete Ensemblespielerin: Beste Beweise dafür sind wie sie gemeinsam mit Jörg Dathe, Mascha Schneider, Paul Willms, Arne Lenk und Alina Wolf / Franziska Melzer in „Antigone“ und mit Nadine Nollau, Franziska Melzer, Henning Strübbe, Philipp Mauritz, Hannes Schumacher und Arne Lenk in „Eure Paläste sind leer“ präzise die hohe Kunst des Sprechchors meistert.
Stichwort Ensemblekunst: Zusammen mit Franziska Melzer, Nadine Nollau, Laura-Maria Hänsel und Charlott Lehmann sorgte Kristin Muthwill für DEN Publikumsrenner der letzten zwei Spielzeiten mit verdienten Standing Ovations für eine exzellente Verkörperung von insgesamt 18 Rollen und meisterhaften Gesang: „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“. Schon das Tempo, mit dem unsere fünf genialen Mädels von einer Rolle in die andere schlüpfen, lässt einem den Atem stocken. Ich konnte mich jedenfalls auch beim 14. Mal nicht sattsehen und genug „Bravos“ rufen…
Unsere heutige Preisträgerin spielt ihre vier Rollen in „Stolz und Vorurteil“ - das Dienstmädchen Tilli, den verliebten Mr. Bingley, seine intrigante Schwester und die naive Charlotte Lukas - einfach sagenhaft. Der Szenenapplaus bei der Klo-Szene, in der sie zeitgleich Charlotte und Mr.Bingley spielt, war ihr immer sicher. Dieses kongeniale „Two in One“ hat zweifellos Maßstäbe gesetzt – sollte aber in Zeiten von Sparzwängen wohl besser nicht Schule machen.
Kristin Muthwill beherrscht ihr Handwerk exzellent – mit toller Bühnenpräsenz und markanter unverwechselbarer Stimme, die auch jede ihrer Lesungen zu einem außergewöhnlichen Hörerlebnis macht: Ob Stefan Zweigs „Briefe einer unbekannten Frau“, ob im Rahmen der „Märkischen Leselust“ - ganz besonders als sie die Texte von Regine Hildebrandt vortrug - oder im Rahmen der Solidaritätsabende für die Ukraine und Israel. Und sie war es, die im Audiowalk rund um das Große Haus „Auf den Spuren des Hans Otto Theaters“Selbigem ihre Stimme gegeben hat.
Dass sie noch ganz andere Register ziehen kann, hat sie schon mehrfach unter Beweis gestellt: mit ihrem wunderbaren Solo - „Max und Moritz“-Abend im Rahmen der damaligen „Nachtschwärmer“, in der Corona-Zeit gemeinsam mit Hennig Strübbe als köstliches Clowns-Duo (für mich bleiben sie die besten Quiz-Master ever!), als „Kleine Hexe“ im köstlichen Zusammenspiel mit Jörg Dathe bei den letzten „SchauSpielFenstern“ oder erst gestern im „Warten auf…“-Marathon von Jon-Karre Koppe und Henning Strübbe im RAhmen von "Inseln der Zukunft". Der improvisierte herrliche Erklärungsversuch des Stuttgarter Fußball-EM-Dramas vom Vortag war für mich der Höhepunkt der 3 ½ Stunden! Und so können wir uns schon auf die Geldhexe Tyrannja im diesjährigen Weihnachtsmärchen „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ freuen.
Jetzt aber gratulieren wir Kristin Muthwill ganz herzlich zum Potsdamer Theaterpreis 2024 und lassen sie hier und heute angemessen hochleben und feiern!
LAUDATIO AUF GUIDO LAMBRECHT
LAUDATIO AUF GUIDO LAMBRECHT
von Lena Schneider
Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Ensemble,
Wie schreibt man als eine Laudatio – als Kritikerin? Einen Text also ohne „wenn“ und „aber“? Der Preisträger des diesjährigen Theaterpreises möge verzeihen, wenn mir zu Beginn dieser Laudatio ein anderer Schauspieler aus der Patsche hilft, der schon den einen oder anderen Preis erhalten hat, und ich ihn hier zitiere – der Schauspieler Fabian Hinrichs.
Vor sechs Jahren war er Juror für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis, und er verlieh ihn an Benny Claessens. Das ist für uns, für den Potsdamer Theaterpreis, nicht wichtig. Was für uns wichtig ist: Hinrichs benannte in seiner vieldiskutierten Rede „die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert“. Die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert, sagt Hinrichs, ist die die: „Bist Du Künstler oder arbeitest Du im Service?“
Das war zugespitzt und ich weiß nicht, ob Guido Lambrecht, ob irgendwer im Ensemble des Hans Otto Theaters das auch so sieht. Aber ich weiß, dass das, was Guido Lambrecht auf der Bühne macht, so aussieht, als hätte er seine Antwort auf die Frage gefunden. Guido Lambrecht ist nicht im „Service“. Guido Lambrecht ist kein Dienstleister. Er dient sich nicht an. Nicht bei der Regie, habe ich gehört – und nicht beim Publikum. Guido Lambrecht stellt zwar seinen Körper, seine Stimme in den Dienst des Theaters – er beherrscht dessen Mittel furios – aber er scheint zugleich die Wirkung, die er erzielt, in Frage zu stellen. Mit schnöder Ironisierung hat das nichts zu tun. Eher mit Durchlässigkeit, glaube ich.
Zur Schauspielkunst von Guido Lambrecht gehört es, dass sie nicht an der Rampe aufhört. Dass er den Raum, in dem er spielt, die Menschen vor denen und mit denen er spielt, wirklich einbezieht. Wie phänomenal das funktionieren kann, hat er in „Die schmutzigen Hände“ gezeigt – eine Inszenierung übrigens, für die alle drei Hauptfiguren den Theaterpreis verdient hätten. Nur kann es leider nur einen geben.
Guido Lambrecht hat wo immer, wann immer er auftritt, eine unerschütterliche, nie anbiedernde, nie eineindeutige Präsenz. Das schreibt sich so einfach dahin, dass es längst Phrase geworden ist. Aber seitdem ich weiß, dass Schauspielkollege Hinrichs den Begriff Präsenz mit "Berührbarkeit" übersetzt hat, benutze ich ihn wieder gern. Guido Lambrecht ist auf der Bühne berührbar. Und deswegen berühren seine Figuren.
Er bündelt Aufmerksamkeit, egal in welcher Rolle. Unter den blökenden Schafen in der Sommerbühnenproduktion „Was ihr wollt“ war er das Trübsinnigste. In „Die Zeit ist aus den Fugen“ sorgte er als Nazi-Professor dafür, dass in der Farce ein wirklicher Abgrund spürbar wurde. In „Arsen und Spitzenhäubchen“ war er ein wunderbar hässlicher Schönheitschirurg, eine monströse Figur, die aber nicht abstieß, sondern Empathie weckte – eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Wo es seicht wird, sorgt er für Tiefe, wo es pathetisch wird, sorgt er für Leichtigkeit. Man kann Guido Lambrecht behelfsweise als „Dagegenspieler“ beschreiben. Er ist ein Schauspieler, der die Irritation sucht, die Reibung – auch an dem, was er selbst auf der Bühne macht. Er sucht den Widerspruch, und ich habe mir sagen lassen, er gibt auch Widerspruch. Wie gesagt: Er ist kein Dienstleister. Das mag nicht immer bequem sein, aber es öffnet den Raum – jedenfalls den im Zuschauer, in der Zuschauerin. Man fühlt sich tatsächlich angesprochen, gefragt. Man kann sich nicht wegducken. Das ist in Zeiten wie diesen nicht zu überschätzen.
Guido Lambrecht spielt nicht gerne Komödien, das ist kein Geheimnis. Vielleicht spielt er sie deswegen so gut, haben wir in der Jurysitzung überlegt. Er versucht nie, lustig zu sein. Er versucht vor allem, so kommt es mir vor, zu sein – im Moment. Und idealerweise da, wo gerade sonst niemand ist. Das tut mehr fürs große Ganze als es jetzt klingt: Es dient der Balance.
Seine Figuren wirken oft einsam. Nirgends offensichtlicher als in „Mephisto“, dem grandiosen Spielzeitauftakt dieser Saison. Da spielt Guido Lambrecht Klaus Mann, eine Figur, die für sich steht auf der Bühne – und die doch die verschiedenen zeitlichen Ebenen zusammenhält. Damals und Heute.
Wenn man Guido Lambrecht zusieht, zweifelt man keine Sekunde, dass das, was er macht, für das Hier und Heute gemacht ist. Egal, welches Kostüm er trägt: Ich fühle mich gemeint, gefragt, gefordert, im besten Fall auch manchmal überfordert. Das ist Guido Lambrechts Verdienst, vielleicht ja dann doch auch sein „Dienst“ am Theater. Dafür erhält er den Theaterpreis 2024. Herzlichen Glückwunsch!
Wie schreibt man als eine Laudatio – als Kritikerin? Einen Text also ohne „wenn“ und „aber“? Der Preisträger des diesjährigen Theaterpreises möge verzeihen, wenn mir zu Beginn dieser Laudatio ein anderer Schauspieler aus der Patsche hilft, der schon den einen oder anderen Preis erhalten hat, und ich ihn hier zitiere – der Schauspieler Fabian Hinrichs.
Vor sechs Jahren war er Juror für den Alfred-Kerr-Darstellerpreis, und er verlieh ihn an Benny Claessens. Das ist für uns, für den Potsdamer Theaterpreis, nicht wichtig. Was für uns wichtig ist: Hinrichs benannte in seiner vieldiskutierten Rede „die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert“. Die wichtigste Frage für Schauspieler im 21. Jahrhundert, sagt Hinrichs, ist die die: „Bist Du Künstler oder arbeitest Du im Service?“
Das war zugespitzt und ich weiß nicht, ob Guido Lambrecht, ob irgendwer im Ensemble des Hans Otto Theaters das auch so sieht. Aber ich weiß, dass das, was Guido Lambrecht auf der Bühne macht, so aussieht, als hätte er seine Antwort auf die Frage gefunden. Guido Lambrecht ist nicht im „Service“. Guido Lambrecht ist kein Dienstleister. Er dient sich nicht an. Nicht bei der Regie, habe ich gehört – und nicht beim Publikum. Guido Lambrecht stellt zwar seinen Körper, seine Stimme in den Dienst des Theaters – er beherrscht dessen Mittel furios – aber er scheint zugleich die Wirkung, die er erzielt, in Frage zu stellen. Mit schnöder Ironisierung hat das nichts zu tun. Eher mit Durchlässigkeit, glaube ich.
Zur Schauspielkunst von Guido Lambrecht gehört es, dass sie nicht an der Rampe aufhört. Dass er den Raum, in dem er spielt, die Menschen vor denen und mit denen er spielt, wirklich einbezieht. Wie phänomenal das funktionieren kann, hat er in „Die schmutzigen Hände“ gezeigt – eine Inszenierung übrigens, für die alle drei Hauptfiguren den Theaterpreis verdient hätten. Nur kann es leider nur einen geben.
Guido Lambrecht hat wo immer, wann immer er auftritt, eine unerschütterliche, nie anbiedernde, nie eineindeutige Präsenz. Das schreibt sich so einfach dahin, dass es längst Phrase geworden ist. Aber seitdem ich weiß, dass Schauspielkollege Hinrichs den Begriff Präsenz mit "Berührbarkeit" übersetzt hat, benutze ich ihn wieder gern. Guido Lambrecht ist auf der Bühne berührbar. Und deswegen berühren seine Figuren.
Er bündelt Aufmerksamkeit, egal in welcher Rolle. Unter den blökenden Schafen in der Sommerbühnenproduktion „Was ihr wollt“ war er das Trübsinnigste. In „Die Zeit ist aus den Fugen“ sorgte er als Nazi-Professor dafür, dass in der Farce ein wirklicher Abgrund spürbar wurde. In „Arsen und Spitzenhäubchen“ war er ein wunderbar hässlicher Schönheitschirurg, eine monströse Figur, die aber nicht abstieß, sondern Empathie weckte – eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Wo es seicht wird, sorgt er für Tiefe, wo es pathetisch wird, sorgt er für Leichtigkeit. Man kann Guido Lambrecht behelfsweise als „Dagegenspieler“ beschreiben. Er ist ein Schauspieler, der die Irritation sucht, die Reibung – auch an dem, was er selbst auf der Bühne macht. Er sucht den Widerspruch, und ich habe mir sagen lassen, er gibt auch Widerspruch. Wie gesagt: Er ist kein Dienstleister. Das mag nicht immer bequem sein, aber es öffnet den Raum – jedenfalls den im Zuschauer, in der Zuschauerin. Man fühlt sich tatsächlich angesprochen, gefragt. Man kann sich nicht wegducken. Das ist in Zeiten wie diesen nicht zu überschätzen.
Guido Lambrecht spielt nicht gerne Komödien, das ist kein Geheimnis. Vielleicht spielt er sie deswegen so gut, haben wir in der Jurysitzung überlegt. Er versucht nie, lustig zu sein. Er versucht vor allem, so kommt es mir vor, zu sein – im Moment. Und idealerweise da, wo gerade sonst niemand ist. Das tut mehr fürs große Ganze als es jetzt klingt: Es dient der Balance.
Seine Figuren wirken oft einsam. Nirgends offensichtlicher als in „Mephisto“, dem grandiosen Spielzeitauftakt dieser Saison. Da spielt Guido Lambrecht Klaus Mann, eine Figur, die für sich steht auf der Bühne – und die doch die verschiedenen zeitlichen Ebenen zusammenhält. Damals und Heute.
Wenn man Guido Lambrecht zusieht, zweifelt man keine Sekunde, dass das, was er macht, für das Hier und Heute gemacht ist. Egal, welches Kostüm er trägt: Ich fühle mich gemeint, gefragt, gefordert, im besten Fall auch manchmal überfordert. Das ist Guido Lambrechts Verdienst, vielleicht ja dann doch auch sein „Dienst“ am Theater. Dafür erhält er den Theaterpreis 2024. Herzlichen Glückwunsch!
REDE VON AUTOR JOHN VON DÜFFEL
Meine Liebeserklärung an das Theater!
von John von Düffel
Wir sind im fünften Akt. Um uns herum herrscht Krieg. Warum, wozu, weiß keiner mehr. Die Narrative sind so oft wiederholt und umgedreht und abgenutzt. Von der Wahrheit ist wenig übrig. Vielleicht gibt es eine Prophezeiung in den Köpfen, irgendwo, ein Versprechen von Erfolg und Frieden, vielleicht sogar Gerechtigkeit. Doch all das liegt in weiter Ferne. Krieg ist Krieg. Und Macbeth in seiner Burg sitzt da und hört die Trommeln seiner Feinde, die schlechten Nachrichten von der Front und vom Selbstmord seiner Frau …
MACBETH
Verloren habe ich den Sinn der Angst
Es gab 'ne Zeit, da überkamen kalte Schauer mich
Beim Schrei der Eule, und meine Haare richteten sich auf,
Als wäre Leben drin. Das ist vorbei.
Ich bin so satt von Grauen:
Mich schreckt nichts mehr.
Die Königin ist tot?
Sie hätte später sterben sollen.
Die Zeit zu trauern hätte sich gefunden.
Morgen, morgen und dann wieder morgen,
So kriecht die Zeit mit müdem Schritt von Tag zu Tag
Bis hin zu unserm letzten Atemzug.
Und unser ganzes Werk war, Narren
In den Tod zu schicken. Aus, aus, du Lichtlein!
Das Leben ist ein Schattenspiel, ein armer
Komödiant, der sich kurz wichtig macht und tönt,
Solang er auf der Bühne steht und dann nie mehr
Gesehn wird; das Ganze ist ein Märchen, erzählt
Von einem Irren, voller Lärm und Zetern,
Und es bedeutet nichts.
Vor ziemlich genau 40 Jahren bin ich im Englisch Leistungskurs zum ersten Mal Shakespeare begegnet. Ich habe mich in sein Stück „Macbeth“ verliebt, genauer gesagt, in Lady Macbeth, diese sprachmächtige, dämonische Frau, die ihren Mann zum Aufstieg anstachelt, zum Mord an seinem König, auf dem blutigen Weg zur Macht und zum noch blutigeren Machterhalt. Doch auch ihre Hände sind rot – rot vom Blut der Ermordeten – und sie findet kein Wasser auf der Welt, keine Tränen, keinen Ozean, um sie wieder weiß zu waschen.
Ich habe damals weniger als ein Drittel des Stückes verstanden und verstehe heute vielleicht knapp die Hälfte. Aber das ist Theatersprache: Ein Satz, im Theater gesprochen, muss nicht bis ins Letzte verstanden werden, er muss im Raum stehen und resonieren, er muss etwas verändern zwischen Menschen – auch denen im Zuschauerraum – von dem man nicht genau weiß oder wissen muss, was es ist.
Es gibt nicht nur eine Theatersprache, schon allein bei Shakespeare, es gibt neben tiefen, dunklen Texten auch helle, leichte, spielerische. Und es gibt viele verschiedene Theatersprachen von Sophokles bis Elfriede Jelinek. Für mich und meine Liebe zum Theater war es Shakespeare, und meine Liebe zum Theater hat dadurch nicht nur eine Dreidimensionalität und Tiefe gewonnen. Sie ging weiter und wurde ein Traum – der Traum, so schreiben zu können, dass die Sätze nicht nur im Raum stehen, sondern Räume eröffnen – den Horizont und die Weite einer Welt.
Ihr wollte ich auf den Grund gehen, der wunderbaren Theateralchimie des William Shakespeare.
Ich konnte Englisch, aber nicht Shakespeare-Englisch und habe den Rest meiner Schulzeit damit verbracht, Shakespeare Englisch zu lernen – im Blankvers und in Bildern zu sprechen. Am Ende hat mich, obwohl ich seit Kindesbeinen Englisch spreche, kein normaler Mensch mehr verstanden.
Das Projekt „Theatersprache“ ist ein lebenslanges und hat für mich nie aufgehört. Es geht immer weiter: als Autor, Dramaturg, Bearbeiter und als Professor für Szenisches Scheiben an der Universität der Künste Berlin. Sprache im Theater hat einen Raum und einen Körper. Darin besteht die kürzeste Definition eines Theaterstücks: Es sind Texte für Körper im Raum. Theatersprache ist geschrieben, um gesprochen zu werden, und sie erklingt nicht einfach nur, sie hat eine Bewegung, Richtung, will etwas verändern und verändert etwas, auch wenn sie scheitert und ihr Ziel nicht erreicht. Sprache im Theater arbeitet – man hört und sieht das nicht immer gleich. Denn manchmal tanzt sie, manchmal träumt sie und schwebt, manchmal wütet sie, schlägt um sich und zertrümmert alles. Aber immer hat sie eine Richtung, einen Vektor und eine Gegenwart. Sie findet im Sprechen statt, Theatersprache ist Jetzt und Hier, in diesem Raum, vor diesen Menschen. Und was gesagt ist, ist gesagt.
Es ist viel passiert auf der Ebene der Formen und Ästhetiken in mehr als zweitausendfünfhundert Jahren Theatergeschichte. Das Theater – auch wenn man es mit einem bestimmten Artikel versieht – ist keine Monokultur und verändert sich fortlaufend. Es hat sich immer mehr formale, inhaltliche und gesellschaftliche Räume erschlossen, hat Diskurse und Dokumentarisches integriert, andere Mittel und Medien, und seinen Charakter als Forum, als gesellschaftlichen Ort immer wieder neu und anders definiert bis in unsere Zeit, in der es für die Stadtgesellschaft einer der letzten analogen Orte der Begegnung und Verständigung ist in der permanenten medialen und digitalen Polarisierung und Spaltung.
Ich habe Ihnen eine Liebeserklärung versprochen – und diese Liebe zum Theater ist nicht nur weit und umfasst vieles, sie reicht zurück bis an die Ursprünge. Die antiken Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides, die den Begriff „Theater“ geprägt haben, wurden im Rahmen der sogenannten Dionysien aufgeführt: Festspielen zu Ehren des Gottes Dionysos. Und sie sind hervorgegangen aus Prozessionen, Gesängen und Tänzen von Chören, die nicht nur kunstvolle Gemeinschaftsrituale waren, sondern vor allem einen Sinn hatten: die Beschwörung eines Gottes. Ihr Sinn war nicht nur die Anbetung, sondern die Vergegenwärtigung von Dionysos, dem Gott des Rausches und des Theaters, eines dunklen, mächtigen Gottes, der die Menschen ergreift und erschüttert.
Die Reaktionen des Publikums, die Wirkung des Theaters auf die Menschen, die es erleben, hat der berühmteste aller Theaterphilosophen, Aristoteles, mit zwei Worten beschrieben: „eleos“ und „phobos“, Jammer und Schaudern, etwas zahmer übersetzt von dem ersten deutschen Dramatiker und Dramaturgen Gotthold Ephraim Lessing - seinerzeit - als Furcht und Mitleid.
Es müssen starke Reaktionen gewesen, entgrenzende, denn die Verbindung von Theater und Rausch im Gott Dionysos weist darauf hin, dass es im Theater nicht nur ums Verstehen geht, sondern um Sinn und Sinnlichkeit, um ein umfassendes Begegnen und Erfahren. Theater ist nicht nur ein Verständigungs- und Erkenntnisraum, sondern ein Ort der Anschauung, des Berührtwerdens, der Nähe. Wenn die ästhetische Erfahrung im Theater wirklich etwas von einer Beschwörung und Vergegenwärtigung hat, dann besteht ihre Wirkung und Schönheit – so würde ich Aristoteles übersetzen – aus Empathie und Erschütterung.
Die Schönheit im Theater – wirkliche Schönheit – ist Erschütterung. Der Rest ist bloß hübsch oder schönes Wetter. Und gerade weil das Theater ein Empathie-Stifter ist, ist die Schönheit der Erschütterung so tief. So wie die Liebe aller, die Theater lieben.
Die Erfindung des Theaters in der griechischen Antike ist der Moment, in dem das Individuum aus dem Chor heraustritt, in dem die Verhandlung zwischen Ich und Gesellschaft beginnt. Eine Verhandlung, bei der wir auf beiden Seiten sind: Jede und jeder von uns ist das zur Gesellschaft sich verhaltende Individuum und die Gesellschaft, erste Person Singular und erste Person Plural, Ich und Wir.
Die Erfindung des Theaters geht nicht zufällig einher mit der Erfindung der Demokratie: beides sind Formen der Gemeinschaftsbildung und Beteiligung, der Selbstverständigung darüber, wer wir sind und was wir wollen. Und darüber wird abgestimmt, in Form der Stimmabgabe per Wahlzettel bzw. Stimmstein oder mit Händeklatschen und Applaus. Der Unterschied besteht nur darin, dass das, was wir die „öffentliche Meinung“ nennen, im Theater nicht durch Meinungsforschungsinstitute erfragt werden muss. Wie das Publikum mitgeht oder sich sperrt, ergriffen ist oder gelangweilt, mitatmet oder hustet – das ist im Theater in jeder Sekunde zu spüren. Theater ist Gemeinschaft in ihrer unmittelbarsten Form, in einem Raum, in Ko-Präsenz. Hier und Jetzt.
Und damit sind wir wieder bei Shakespeare, der Theatersprache und den Inhalten, die sie aufschließt. Theater meint immer den ganzen Menschen, nicht nur seinen Verstand, sondern sein Herz, seine Sinne, seine Erinnerung. Das war es, was die Dramatiker der Antike entdeckt haben und was die Polis – die Stadtgesellschaft von Athen – bei ihnen suchte: die Erfindung der Figur in einer Situation, die ihr das Äußerste abverlangt, die Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft, Mensch und Schicksal, das ihn an Grenzen bringt, seine Grenzen, und so erfahrbar macht, wer oder was er ist. Es sind extreme Situationen, Zerreißproben, Grenzüberschreitungen, in denen Identität erlebbar wird: die extreme Situation des Ödipus in seiner Schuld, der Antigone in ihrem Protest, der Medea in ihrer Demütigung zeigt, wozu die Einzelnen fähig sind – im Guten wie im Schlechten.
Nichts ist ungeheurer als der Mensch, heißt es im Chor der „Antigone“. Davon handelt das Theater seit über zweitausendfünfhundert Jahren.
Daher meine Liebe zum Theater – wenn sie überhaupt einen Grund braucht. Theater ist der beste Ort, sich selbst und die Gesellschaft zu verstehen. Nicht nur rational, sondern auch emotional. Von Kopf bis Fuß. In Empathie und Erschütterung.
Das Maß, in dem die Demokratie bedroht ist, zeigt sich in dem Maß, in dem das Theater bedroht ist. Das Verschwinden des Theaters ist ein Gradmesser für das Verschwinden der Demokratie. Wenn man nicht mehr miteinander in einem Raum sein kann, wenn es keinen Ort der gemeinschaftlichen Verständigung und Empathie mehr gibt, dann herrschen Spaltung, Unverständnis und Hass.
Ich komme zum Schluss und lobe nun doch – nicht nur das Theater an sich, sondern speziell dieses Theater. Dass ich nicht nur von fernen Zeiten rede und großen Theatererlebnissen der Vergangenheit, zeigen viele Beispiele aus dieser Spielzeit. Ich greife eins heraus. Hier an dieser Stelle ist eines der ältesten Stücke der Welt sehr gegenwärtig geworden dank Bettina Jahnkes Inszenierung von ANTIGONE in dem kongenialen Raum von Claudia Rohner, der uns als Publikum und zuschauende Gesellschaft ins Geschehen und in die Geschichte setzt. Es lässt uns teilhaben an dem Grenzgang von Antigone und dem hohen Preis, den sie für ihren Protest zahlen muss. Das großartige Ensemble macht den Chor in seiner Musikalität und Vielgestaltigkeit erfahrbar, den Widerstand, den Zweifel genauso wie die Verblendung von König Kreon, der gefangen ist in der fatalen Logik seines politischen Handels, begleitet von Teiresias, dem blinden Seher, dem Ratgeber, den keiner hören will. Mit seinen Schlussworten will ich schließen und spreche mit Teiresias zum ratlos gewordenen König:
TEIRESIAS: Ich wünschte selbst, ich hätte
Licht für dich und könnte dir den Weg weissagen,
Allein, ich bin am Ende meiner Seherkunst.
An alter Stelle, Vogel schauend, saß ich,
Da hör ich unbekannter Tiere Stimme, Krähen,
Geier, krächzend, in sinnlosem Geschrei;
Voll Sorge bracht ich Brandopfer den Göttern,
Doch die Feuer loderten nicht auf,
Und in dem Rauch war der Geruch von Tod.
Gedunsen und hoch aufgebläht, platzten
Die Bäuche, und die Knochen lagen abgeschmolzen da,
Verkohlt und ohne Zeichen, deutungslos!
Die Götter wenden sich von unsern Opfern
Und Gebeten ab!
Die Zukunft ist verschlossen, kein Lichtstrahl
Fällt mehr durch die Tür der Zeit,
Ich bin so blind und ahnungslos wie ihr,
Und alles, was mir bleibt, ist mein Verstand.
Dies nur bedenke, Kreon, den Menschen ist gemeinsam,
Dass sie irren, doch ist nur der von Rat und Glück
Verlassen, der im Irrtum immer weiter geht!
Kreon, ich bitte dich: Dem Friedlosen gib seinen Frieden
Und gib dem toten Mann sein Grab.
Ich liebe es.
Vielen Dank!
MACBETH
Verloren habe ich den Sinn der Angst
Es gab 'ne Zeit, da überkamen kalte Schauer mich
Beim Schrei der Eule, und meine Haare richteten sich auf,
Als wäre Leben drin. Das ist vorbei.
Ich bin so satt von Grauen:
Mich schreckt nichts mehr.
Die Königin ist tot?
Sie hätte später sterben sollen.
Die Zeit zu trauern hätte sich gefunden.
Morgen, morgen und dann wieder morgen,
So kriecht die Zeit mit müdem Schritt von Tag zu Tag
Bis hin zu unserm letzten Atemzug.
Und unser ganzes Werk war, Narren
In den Tod zu schicken. Aus, aus, du Lichtlein!
Das Leben ist ein Schattenspiel, ein armer
Komödiant, der sich kurz wichtig macht und tönt,
Solang er auf der Bühne steht und dann nie mehr
Gesehn wird; das Ganze ist ein Märchen, erzählt
Von einem Irren, voller Lärm und Zetern,
Und es bedeutet nichts.
Vor ziemlich genau 40 Jahren bin ich im Englisch Leistungskurs zum ersten Mal Shakespeare begegnet. Ich habe mich in sein Stück „Macbeth“ verliebt, genauer gesagt, in Lady Macbeth, diese sprachmächtige, dämonische Frau, die ihren Mann zum Aufstieg anstachelt, zum Mord an seinem König, auf dem blutigen Weg zur Macht und zum noch blutigeren Machterhalt. Doch auch ihre Hände sind rot – rot vom Blut der Ermordeten – und sie findet kein Wasser auf der Welt, keine Tränen, keinen Ozean, um sie wieder weiß zu waschen.
Ich habe damals weniger als ein Drittel des Stückes verstanden und verstehe heute vielleicht knapp die Hälfte. Aber das ist Theatersprache: Ein Satz, im Theater gesprochen, muss nicht bis ins Letzte verstanden werden, er muss im Raum stehen und resonieren, er muss etwas verändern zwischen Menschen – auch denen im Zuschauerraum – von dem man nicht genau weiß oder wissen muss, was es ist.
Es gibt nicht nur eine Theatersprache, schon allein bei Shakespeare, es gibt neben tiefen, dunklen Texten auch helle, leichte, spielerische. Und es gibt viele verschiedene Theatersprachen von Sophokles bis Elfriede Jelinek. Für mich und meine Liebe zum Theater war es Shakespeare, und meine Liebe zum Theater hat dadurch nicht nur eine Dreidimensionalität und Tiefe gewonnen. Sie ging weiter und wurde ein Traum – der Traum, so schreiben zu können, dass die Sätze nicht nur im Raum stehen, sondern Räume eröffnen – den Horizont und die Weite einer Welt.
Ihr wollte ich auf den Grund gehen, der wunderbaren Theateralchimie des William Shakespeare.
Ich konnte Englisch, aber nicht Shakespeare-Englisch und habe den Rest meiner Schulzeit damit verbracht, Shakespeare Englisch zu lernen – im Blankvers und in Bildern zu sprechen. Am Ende hat mich, obwohl ich seit Kindesbeinen Englisch spreche, kein normaler Mensch mehr verstanden.
Das Projekt „Theatersprache“ ist ein lebenslanges und hat für mich nie aufgehört. Es geht immer weiter: als Autor, Dramaturg, Bearbeiter und als Professor für Szenisches Scheiben an der Universität der Künste Berlin. Sprache im Theater hat einen Raum und einen Körper. Darin besteht die kürzeste Definition eines Theaterstücks: Es sind Texte für Körper im Raum. Theatersprache ist geschrieben, um gesprochen zu werden, und sie erklingt nicht einfach nur, sie hat eine Bewegung, Richtung, will etwas verändern und verändert etwas, auch wenn sie scheitert und ihr Ziel nicht erreicht. Sprache im Theater arbeitet – man hört und sieht das nicht immer gleich. Denn manchmal tanzt sie, manchmal träumt sie und schwebt, manchmal wütet sie, schlägt um sich und zertrümmert alles. Aber immer hat sie eine Richtung, einen Vektor und eine Gegenwart. Sie findet im Sprechen statt, Theatersprache ist Jetzt und Hier, in diesem Raum, vor diesen Menschen. Und was gesagt ist, ist gesagt.
Es ist viel passiert auf der Ebene der Formen und Ästhetiken in mehr als zweitausendfünfhundert Jahren Theatergeschichte. Das Theater – auch wenn man es mit einem bestimmten Artikel versieht – ist keine Monokultur und verändert sich fortlaufend. Es hat sich immer mehr formale, inhaltliche und gesellschaftliche Räume erschlossen, hat Diskurse und Dokumentarisches integriert, andere Mittel und Medien, und seinen Charakter als Forum, als gesellschaftlichen Ort immer wieder neu und anders definiert bis in unsere Zeit, in der es für die Stadtgesellschaft einer der letzten analogen Orte der Begegnung und Verständigung ist in der permanenten medialen und digitalen Polarisierung und Spaltung.
Ich habe Ihnen eine Liebeserklärung versprochen – und diese Liebe zum Theater ist nicht nur weit und umfasst vieles, sie reicht zurück bis an die Ursprünge. Die antiken Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides, die den Begriff „Theater“ geprägt haben, wurden im Rahmen der sogenannten Dionysien aufgeführt: Festspielen zu Ehren des Gottes Dionysos. Und sie sind hervorgegangen aus Prozessionen, Gesängen und Tänzen von Chören, die nicht nur kunstvolle Gemeinschaftsrituale waren, sondern vor allem einen Sinn hatten: die Beschwörung eines Gottes. Ihr Sinn war nicht nur die Anbetung, sondern die Vergegenwärtigung von Dionysos, dem Gott des Rausches und des Theaters, eines dunklen, mächtigen Gottes, der die Menschen ergreift und erschüttert.
Die Reaktionen des Publikums, die Wirkung des Theaters auf die Menschen, die es erleben, hat der berühmteste aller Theaterphilosophen, Aristoteles, mit zwei Worten beschrieben: „eleos“ und „phobos“, Jammer und Schaudern, etwas zahmer übersetzt von dem ersten deutschen Dramatiker und Dramaturgen Gotthold Ephraim Lessing - seinerzeit - als Furcht und Mitleid.
Es müssen starke Reaktionen gewesen, entgrenzende, denn die Verbindung von Theater und Rausch im Gott Dionysos weist darauf hin, dass es im Theater nicht nur ums Verstehen geht, sondern um Sinn und Sinnlichkeit, um ein umfassendes Begegnen und Erfahren. Theater ist nicht nur ein Verständigungs- und Erkenntnisraum, sondern ein Ort der Anschauung, des Berührtwerdens, der Nähe. Wenn die ästhetische Erfahrung im Theater wirklich etwas von einer Beschwörung und Vergegenwärtigung hat, dann besteht ihre Wirkung und Schönheit – so würde ich Aristoteles übersetzen – aus Empathie und Erschütterung.
Die Schönheit im Theater – wirkliche Schönheit – ist Erschütterung. Der Rest ist bloß hübsch oder schönes Wetter. Und gerade weil das Theater ein Empathie-Stifter ist, ist die Schönheit der Erschütterung so tief. So wie die Liebe aller, die Theater lieben.
Die Erfindung des Theaters in der griechischen Antike ist der Moment, in dem das Individuum aus dem Chor heraustritt, in dem die Verhandlung zwischen Ich und Gesellschaft beginnt. Eine Verhandlung, bei der wir auf beiden Seiten sind: Jede und jeder von uns ist das zur Gesellschaft sich verhaltende Individuum und die Gesellschaft, erste Person Singular und erste Person Plural, Ich und Wir.
Die Erfindung des Theaters geht nicht zufällig einher mit der Erfindung der Demokratie: beides sind Formen der Gemeinschaftsbildung und Beteiligung, der Selbstverständigung darüber, wer wir sind und was wir wollen. Und darüber wird abgestimmt, in Form der Stimmabgabe per Wahlzettel bzw. Stimmstein oder mit Händeklatschen und Applaus. Der Unterschied besteht nur darin, dass das, was wir die „öffentliche Meinung“ nennen, im Theater nicht durch Meinungsforschungsinstitute erfragt werden muss. Wie das Publikum mitgeht oder sich sperrt, ergriffen ist oder gelangweilt, mitatmet oder hustet – das ist im Theater in jeder Sekunde zu spüren. Theater ist Gemeinschaft in ihrer unmittelbarsten Form, in einem Raum, in Ko-Präsenz. Hier und Jetzt.
Und damit sind wir wieder bei Shakespeare, der Theatersprache und den Inhalten, die sie aufschließt. Theater meint immer den ganzen Menschen, nicht nur seinen Verstand, sondern sein Herz, seine Sinne, seine Erinnerung. Das war es, was die Dramatiker der Antike entdeckt haben und was die Polis – die Stadtgesellschaft von Athen – bei ihnen suchte: die Erfindung der Figur in einer Situation, die ihr das Äußerste abverlangt, die Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft, Mensch und Schicksal, das ihn an Grenzen bringt, seine Grenzen, und so erfahrbar macht, wer oder was er ist. Es sind extreme Situationen, Zerreißproben, Grenzüberschreitungen, in denen Identität erlebbar wird: die extreme Situation des Ödipus in seiner Schuld, der Antigone in ihrem Protest, der Medea in ihrer Demütigung zeigt, wozu die Einzelnen fähig sind – im Guten wie im Schlechten.
Nichts ist ungeheurer als der Mensch, heißt es im Chor der „Antigone“. Davon handelt das Theater seit über zweitausendfünfhundert Jahren.
Daher meine Liebe zum Theater – wenn sie überhaupt einen Grund braucht. Theater ist der beste Ort, sich selbst und die Gesellschaft zu verstehen. Nicht nur rational, sondern auch emotional. Von Kopf bis Fuß. In Empathie und Erschütterung.
Das Maß, in dem die Demokratie bedroht ist, zeigt sich in dem Maß, in dem das Theater bedroht ist. Das Verschwinden des Theaters ist ein Gradmesser für das Verschwinden der Demokratie. Wenn man nicht mehr miteinander in einem Raum sein kann, wenn es keinen Ort der gemeinschaftlichen Verständigung und Empathie mehr gibt, dann herrschen Spaltung, Unverständnis und Hass.
Ich komme zum Schluss und lobe nun doch – nicht nur das Theater an sich, sondern speziell dieses Theater. Dass ich nicht nur von fernen Zeiten rede und großen Theatererlebnissen der Vergangenheit, zeigen viele Beispiele aus dieser Spielzeit. Ich greife eins heraus. Hier an dieser Stelle ist eines der ältesten Stücke der Welt sehr gegenwärtig geworden dank Bettina Jahnkes Inszenierung von ANTIGONE in dem kongenialen Raum von Claudia Rohner, der uns als Publikum und zuschauende Gesellschaft ins Geschehen und in die Geschichte setzt. Es lässt uns teilhaben an dem Grenzgang von Antigone und dem hohen Preis, den sie für ihren Protest zahlen muss. Das großartige Ensemble macht den Chor in seiner Musikalität und Vielgestaltigkeit erfahrbar, den Widerstand, den Zweifel genauso wie die Verblendung von König Kreon, der gefangen ist in der fatalen Logik seines politischen Handels, begleitet von Teiresias, dem blinden Seher, dem Ratgeber, den keiner hören will. Mit seinen Schlussworten will ich schließen und spreche mit Teiresias zum ratlos gewordenen König:
TEIRESIAS: Ich wünschte selbst, ich hätte
Licht für dich und könnte dir den Weg weissagen,
Allein, ich bin am Ende meiner Seherkunst.
An alter Stelle, Vogel schauend, saß ich,
Da hör ich unbekannter Tiere Stimme, Krähen,
Geier, krächzend, in sinnlosem Geschrei;
Voll Sorge bracht ich Brandopfer den Göttern,
Doch die Feuer loderten nicht auf,
Und in dem Rauch war der Geruch von Tod.
Gedunsen und hoch aufgebläht, platzten
Die Bäuche, und die Knochen lagen abgeschmolzen da,
Verkohlt und ohne Zeichen, deutungslos!
Die Götter wenden sich von unsern Opfern
Und Gebeten ab!
Die Zukunft ist verschlossen, kein Lichtstrahl
Fällt mehr durch die Tür der Zeit,
Ich bin so blind und ahnungslos wie ihr,
Und alles, was mir bleibt, ist mein Verstand.
Dies nur bedenke, Kreon, den Menschen ist gemeinsam,
Dass sie irren, doch ist nur der von Rat und Glück
Verlassen, der im Irrtum immer weiter geht!
Kreon, ich bitte dich: Dem Friedlosen gib seinen Frieden
Und gib dem toten Mann sein Grab.
Ich liebe es.
Vielen Dank!