Verloren im Machtraum
Bühnenbildnerin Nehle Balkhausen über Sartres Die schmutzigen Hände, zeitlose Räume und futuristisch verpackte Möbel
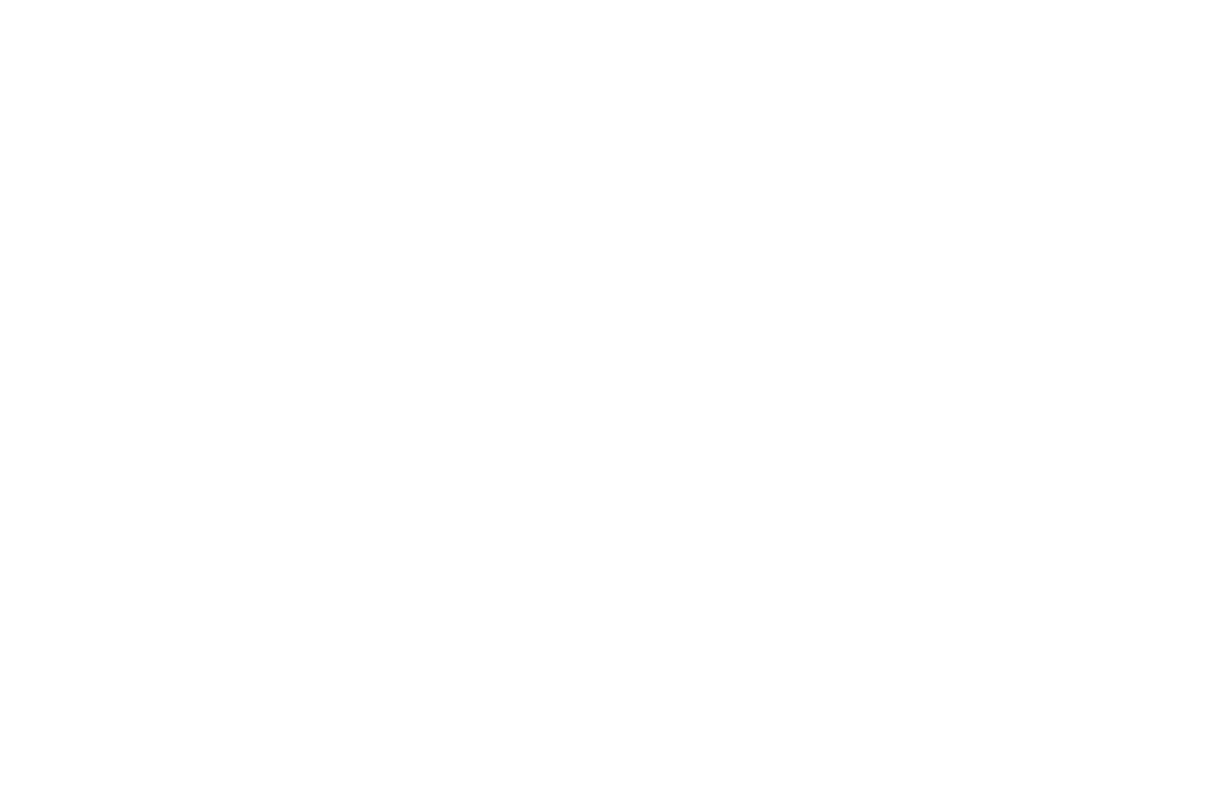
Paul Sies (Hugo), Mascha Schneider (Jessica), und Guido Lambrecht (Hoederer) in "Die schmutzigen Hände"
Jean-Paul Sartres Stück „Die schmutzigen Hände“ ist wie ein Agententhriller gebaut. Ursprünglich war es für den Broadway geplant. In Potsdam entdeckt Regisseur Christoph Mehler nun die Groteske im Drama. Nehle Balkhausen hat die Bühne für die Inszenierung entworfen.
Sartres „Die schmutzigen Hände“ kommt als Agententhriller daher und trägt zugleich Züge einer Farce – Regisseur Christoph Mehler hat es auch als „Existenzialisten-Comic“ bezeichnet. Wie empfindest du das Stück?
Nehle Balkhausen: Schon beim gemeinsamen Lesen des Textes haben wir gemerkt, dass es ein gewisses Tempo und eine starke Dynamik braucht, um einen reizvollen Umgang damit zu finden. Das hat bei mir unter anderem so eine tarantinohafte Fantasie ausgelöst. Uns schwebte eine starke Überzeichnung vor, die sich während des Probenprozesses bestätigt hat.
Wie hast du dich als Bühnenbildnerin diesem Stoff angenähert?
Ich habe mich natürlich mit der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt, aus der heraus Sartre das Stück geschrieben hat. Die Erkenntnis – oder vielleicht auch der Fluch – der eigenen Freiheit, die Verantwortung für das eigene Handeln, dieser Punkt, dass man im Grunde immer eine Wahl hat in den Entscheidungen, die man für sich trifft, macht ja erstmal etwas Großes auf: Alles ist möglich. Die Bühne verhält sich dazu wie eine Gegenbewegung: Es ist ein sehr geschlossener, drückender, fast klaustrophobischer Raum.
Wofür steht diese Bühne?
Sie ist Machtraum und zugleich Hinterzimmer, dessen Dimension die Figuren wie unter eine Lupe nimmt. Sie sind ja die ganze Zeit in einer Art Kampf, mit sich selbst und ihrer Umwelt. Die Größe und Leere dieses Raumes stellt diesen Kampf aus. Durch die Verwendung riesiger Mengen von Folie, die den gesamten Raum von innen bedeckt, ist die philosophische Frage nach der Essenz der Dinge und dem, was dahinter liegt, auch haptisch gestellt.
Das Stück ist in den späten vierziger Jahren entstanden. Ist der Raum, den du entworfen hast, historisch oder zeitlos?
Ich würde sagen, er ist zeitlos. Ich habe versucht, eine eigene Art von Ästhetik zu entwickeln. Es gibt zwar einen Teppichboden, drei Stühle, einen Tisch, eine Tür und einen Kamin. Das hört sich sehr naturalistisch an, ist aber extrem reduziert. Die Möbel sind alle verpackt. Dieser Raum hat fast einen futuristischen Ansatz. Eine zeitliche Einordnung ist gar nicht möglich.
Mit dem Regisseur Christoph Mehler arbeitest du seit 2007 zusammen. Was verbindet euch beide?
Wir haben gemeinsam am Deutschen Theater Berlin begonnen, Theater zu machen. Dadurch, dass wir so jung waren, haben wir eine schöne Art und Weise entwickelt, offen und frei miteinander zu diskutieren. Christoph ist jemand, der mit unheimlich viel Energie in die Arbeit reingeht und begeistern kann. Das schätze ich sehr an ihm.
Interview: Björn Achenbach
erschienen in: ZUGABE 03-2022
Sartres „Die schmutzigen Hände“ kommt als Agententhriller daher und trägt zugleich Züge einer Farce – Regisseur Christoph Mehler hat es auch als „Existenzialisten-Comic“ bezeichnet. Wie empfindest du das Stück?
Nehle Balkhausen: Schon beim gemeinsamen Lesen des Textes haben wir gemerkt, dass es ein gewisses Tempo und eine starke Dynamik braucht, um einen reizvollen Umgang damit zu finden. Das hat bei mir unter anderem so eine tarantinohafte Fantasie ausgelöst. Uns schwebte eine starke Überzeichnung vor, die sich während des Probenprozesses bestätigt hat.
Wie hast du dich als Bühnenbildnerin diesem Stoff angenähert?
Ich habe mich natürlich mit der Philosophie des Existenzialismus beschäftigt, aus der heraus Sartre das Stück geschrieben hat. Die Erkenntnis – oder vielleicht auch der Fluch – der eigenen Freiheit, die Verantwortung für das eigene Handeln, dieser Punkt, dass man im Grunde immer eine Wahl hat in den Entscheidungen, die man für sich trifft, macht ja erstmal etwas Großes auf: Alles ist möglich. Die Bühne verhält sich dazu wie eine Gegenbewegung: Es ist ein sehr geschlossener, drückender, fast klaustrophobischer Raum.
Wofür steht diese Bühne?
Sie ist Machtraum und zugleich Hinterzimmer, dessen Dimension die Figuren wie unter eine Lupe nimmt. Sie sind ja die ganze Zeit in einer Art Kampf, mit sich selbst und ihrer Umwelt. Die Größe und Leere dieses Raumes stellt diesen Kampf aus. Durch die Verwendung riesiger Mengen von Folie, die den gesamten Raum von innen bedeckt, ist die philosophische Frage nach der Essenz der Dinge und dem, was dahinter liegt, auch haptisch gestellt.
Das Stück ist in den späten vierziger Jahren entstanden. Ist der Raum, den du entworfen hast, historisch oder zeitlos?
Ich würde sagen, er ist zeitlos. Ich habe versucht, eine eigene Art von Ästhetik zu entwickeln. Es gibt zwar einen Teppichboden, drei Stühle, einen Tisch, eine Tür und einen Kamin. Das hört sich sehr naturalistisch an, ist aber extrem reduziert. Die Möbel sind alle verpackt. Dieser Raum hat fast einen futuristischen Ansatz. Eine zeitliche Einordnung ist gar nicht möglich.
Mit dem Regisseur Christoph Mehler arbeitest du seit 2007 zusammen. Was verbindet euch beide?
Wir haben gemeinsam am Deutschen Theater Berlin begonnen, Theater zu machen. Dadurch, dass wir so jung waren, haben wir eine schöne Art und Weise entwickelt, offen und frei miteinander zu diskutieren. Christoph ist jemand, der mit unheimlich viel Energie in die Arbeit reingeht und begeistern kann. Das schätze ich sehr an ihm.
Interview: Björn Achenbach
erschienen in: ZUGABE 03-2022
Geboren, um frei zu sein
Über Sartre und den Existenzialismus

Raus ins Leben: Jean-Paul Sartre (l.), Partnerin Simone de Beauvoir (r.)
„Von unserer Zeit wollen wir nichts versäumen: vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber dies ist unsere Zeit“, schreibt der französische Philosoph und Schriftsteller Jean-Paul Sartre im Oktober 1945. Obwohl der Zweite Weltkrieg gerade den Glauben an die Werte der Humanität in eine tiefe Krise gestürzt hat, erstarren Sartre und seine Freunde nicht in Resignation, sondern begründen – im Gegenteil – eine philosophische Bewegung, die von einer ungeheuren Aufbruchsenergie getragen ist: Sie nennt sich Existenzialismus und will eine Philosophie für das Leben sein. Ihr kühner, provokativer Grundgedanke: Der Mensch ist Freiheit!
Es ist ein Gedanke, der schwindlig machen kann – wie ein Abgrund: Alle Stützpfeiler, die Halt und Orientierung geben – Werte, Traditionen, Herkunft, Identität – sind in dieser Weltsicht niedergerissen. Nichts ist festgelegt. Mit jeder Entscheidung, mit jeder Handlung können wir bestimmen, wer wir sind, wer wir sein wollen. Sartre hält es für unaufrichtig zu behaupten, wir seien bloße Produkte unserer Gene, Klasse, Geschichte, Nation, Familie, Triebe. Das seien nur Ausreden, mit denen wir die Verantwortung für unser Leben wegschieben. Seine Philosophie ist eine Zumutung, im positiven Sinne. Aus ihr spricht ein großes Zutrauen in die Möglichkeiten des Menschseins. Selbst im Krieg, im Gefängnis, in schwerer Krankheit, sogar im Tod kann uns die Freiheit nicht genommen werden. Wir können entscheiden, wie wir diesen Situationen begegnen. „Nie sind wir freier gewesen als unter deutscher Besatzung“, lautet eine paradox anmutende Formulierung Sartres.
Im Paris der 1940er Jahre übersetzten die jungen Existenzialisten diesen Freiheitsgedanken in konkrete Praxis, in eine Explosion von Lebensenergie. Ihr Gestus war durch und durch antibürgerlich. Es ging darum, Konventionen und Verkrustungen aufzubrechen. Es ging um lange Nächte in Jazzclubs. Es ging um Trinken, Rauchen, Kunst, Sex, Literatur, Tanzen, große Fragen, coole Filme, freie Liebe. Und es ging darum, die Welt zu verbessern. Für Gerechtigkeit einzustehen. Denn die Existenzialisten waren keine spaßgetriebenen Partypeople, die sich selbstverliebt um den eigenen Bauchnabel drehten. Auch keine erfolgsversessenen Selbstverwirklicher im Sinne des Neoliberalismus. In Sartres Philosophie wird das Ich erst ein Ich, wenn es sich zu einem Gegenüber in Beziehung setzt, wenn es bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die anderen, für die Mitwelt. So prägte Sartre den Begriff der engagierten Literatur, setzte sich ein für die Unterdrückten, Ausgebeuteten und Entrechteten, kämpfte gegen Rassismus, Kolonialismus und den Vietnamkrieg. Dabei waren seine Ideen keine dogmatischen Gedankengebäude, sondern immer nur vorläufig und offen für Korrekturen. Nächtelang diskutierten die jungen Existenzialisten in verrauchten Jazzclubs über Politik, Revolution und Kommunismus. Ihre aufregenden Debatten finden einen Niederschlag in Sartres Drama „Die schmutzigen Hände“. Im Stück wird intensiv um das Verhältnis von großen Weltverbesserungsidealen und der Notwendigkeit von realpolitischen Kompromissen gerungen. Dabei kommt es zu einem aberwitzigen Tanz auf Messers Schneide zwischen Komik und Existenzialismus, Spiel und Ernst, Liebe und Politik, Sex und Macht.
Jean-Paul Sartre und seine Partnerin Simone de Beauvoir hatten in den 40er Jahren keine feste Wohnung, sondern schliefen in oftmals unbeheizten Hotelzimmern. Die meiste Zeit arbeiteten und verbrachten sie in den trubeligen Cafés – dort war es geselliger, interessanter, lebendiger und wärmer. Rausgehen, aus den Umständen das Beste machen, sich im Provisorischen einrichten, in öffentlichen Räumen Begegnungen suchen, statt sich in den behaglichen Kokon des Privaten zurückziehen – all das kennzeichnete den subversiv-exzessiven Lebensstil der Existenzialisten. Ihre Bereitschaft, entschlossen auf das Leben zuzugehen, wie es sich jeweils zeigt, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Schicksal und die Mitmenschen, anstatt zu jammern und sich in der Opferrolle einzurichten – diese ermutigende Haltung könnte uns gut tun in den gegenwärtigen krisenbewegten Zeiten.
Christopher Hanf
erschienen in: ZUGABE 03-2022
Es ist ein Gedanke, der schwindlig machen kann – wie ein Abgrund: Alle Stützpfeiler, die Halt und Orientierung geben – Werte, Traditionen, Herkunft, Identität – sind in dieser Weltsicht niedergerissen. Nichts ist festgelegt. Mit jeder Entscheidung, mit jeder Handlung können wir bestimmen, wer wir sind, wer wir sein wollen. Sartre hält es für unaufrichtig zu behaupten, wir seien bloße Produkte unserer Gene, Klasse, Geschichte, Nation, Familie, Triebe. Das seien nur Ausreden, mit denen wir die Verantwortung für unser Leben wegschieben. Seine Philosophie ist eine Zumutung, im positiven Sinne. Aus ihr spricht ein großes Zutrauen in die Möglichkeiten des Menschseins. Selbst im Krieg, im Gefängnis, in schwerer Krankheit, sogar im Tod kann uns die Freiheit nicht genommen werden. Wir können entscheiden, wie wir diesen Situationen begegnen. „Nie sind wir freier gewesen als unter deutscher Besatzung“, lautet eine paradox anmutende Formulierung Sartres.
Im Paris der 1940er Jahre übersetzten die jungen Existenzialisten diesen Freiheitsgedanken in konkrete Praxis, in eine Explosion von Lebensenergie. Ihr Gestus war durch und durch antibürgerlich. Es ging darum, Konventionen und Verkrustungen aufzubrechen. Es ging um lange Nächte in Jazzclubs. Es ging um Trinken, Rauchen, Kunst, Sex, Literatur, Tanzen, große Fragen, coole Filme, freie Liebe. Und es ging darum, die Welt zu verbessern. Für Gerechtigkeit einzustehen. Denn die Existenzialisten waren keine spaßgetriebenen Partypeople, die sich selbstverliebt um den eigenen Bauchnabel drehten. Auch keine erfolgsversessenen Selbstverwirklicher im Sinne des Neoliberalismus. In Sartres Philosophie wird das Ich erst ein Ich, wenn es sich zu einem Gegenüber in Beziehung setzt, wenn es bereit ist, Verantwortung zu übernehmen für die anderen, für die Mitwelt. So prägte Sartre den Begriff der engagierten Literatur, setzte sich ein für die Unterdrückten, Ausgebeuteten und Entrechteten, kämpfte gegen Rassismus, Kolonialismus und den Vietnamkrieg. Dabei waren seine Ideen keine dogmatischen Gedankengebäude, sondern immer nur vorläufig und offen für Korrekturen. Nächtelang diskutierten die jungen Existenzialisten in verrauchten Jazzclubs über Politik, Revolution und Kommunismus. Ihre aufregenden Debatten finden einen Niederschlag in Sartres Drama „Die schmutzigen Hände“. Im Stück wird intensiv um das Verhältnis von großen Weltverbesserungsidealen und der Notwendigkeit von realpolitischen Kompromissen gerungen. Dabei kommt es zu einem aberwitzigen Tanz auf Messers Schneide zwischen Komik und Existenzialismus, Spiel und Ernst, Liebe und Politik, Sex und Macht.
Jean-Paul Sartre und seine Partnerin Simone de Beauvoir hatten in den 40er Jahren keine feste Wohnung, sondern schliefen in oftmals unbeheizten Hotelzimmern. Die meiste Zeit arbeiteten und verbrachten sie in den trubeligen Cafés – dort war es geselliger, interessanter, lebendiger und wärmer. Rausgehen, aus den Umständen das Beste machen, sich im Provisorischen einrichten, in öffentlichen Räumen Begegnungen suchen, statt sich in den behaglichen Kokon des Privaten zurückziehen – all das kennzeichnete den subversiv-exzessiven Lebensstil der Existenzialisten. Ihre Bereitschaft, entschlossen auf das Leben zuzugehen, wie es sich jeweils zeigt, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Schicksal und die Mitmenschen, anstatt zu jammern und sich in der Opferrolle einzurichten – diese ermutigende Haltung könnte uns gut tun in den gegenwärtigen krisenbewegten Zeiten.
Christopher Hanf
erschienen in: ZUGABE 03-2022
"Eine verzweifelte, absurde Komik"
Regisseur Christoph Mehler im Gespräch
Das Publikum geht mit Hugo durchs Stück. Wie siehst du diese Figur?
Christoph Mehler: Was Hugo antreibt, ist nicht zuletzt seine privilegierte bürgerliche Herkunft, die Rebellion gegen sein wohlhabendes Elternhaus. Gegenüber den Unterprivilegierten empfindet er eine Art Schuldkomplex: dass er – anders als sie – keinen Hunger leiden musste. Er will dazugehören zu den Arbeitern und so Anerkennung erfahren. Dabei entwickelt er einen verbohrten, dogmatischen Idealismus, der ihn zu Gewalttaten, ja zum Mord anstachelt. Andererseits ist er in seinem Herzen kein kalter Killer und eigentlich zu weich für die Welt der Partisanen, Funktionäre und Parteisoldaten, in die er sich begeben hat. So fällt es ihm, wie Shakespeares Hamlet, extrem schwer, den Mord auszuführen, zu dem er sich verpflichtet fühlt.
Ist der Realpolitiker Hoederer der positive Held im Stück?
Positiv an ihm erscheint, dass er kein starrköpfiger Ideologe ist, der über Leichen geht, sondern begriffen hat, dass die Wirklichkeit komplex ist und man das absolut Gute auf dieser Welt nicht erreichen kann. Er konzentriert sich auf das Machbare und verfolgt eine Kompromissstrategie. Aber er ist kein Held. Hoederer hat die Tendenz, sich selbstgefällig in seiner Machtposition einzurichten. Er besitzt eine charismatische Persönlichkeit, die ihn aber anfällig für Eitelkeit macht. Dabei steht er in der Gefahr, seine Ideale, für die er ursprünglich angetreten ist, aus dem Blick zu verlieren.
Und was ist mit Hugos Frau Jessica?
Sie macht vielleicht die größte Entwicklung im Stück durch. Anfangs begegnet sie allem mit einer wilden, fast kindlichen Spiellust. Es fällt ihr schwer, irgendetwas ernst zu nehmen. Sie beginnt aber zu verstehen, dass die Regeln dieses Spiels falsch sind, besonders diejenigen, die von den traditionellen, machomäßigen Bildern der Männlichkeit bestimmt werden, von Krieg, Gewalt, Macht und Herrschaft. In einem Akt der Emanzipation befreit sie sich von diesen Regeln. Zugleich ist Jessica auch eine egoistische Figur: Sie nimmt sich, was sie will, ohne Rücksicht auf Konventionen. Außerdem bringt sie eine erotische Komponente ins Spiel. Sartre ist so klug zu wissen, dass Liebe und Sex ein mindestens genauso starker Antriebsmotor von Menschen sind wie ihr politischer Kampf um Ideale und Macht.
Die Inszenierung arbeitet mit Mitteln der Überhöhung, Zuspitzung, Groteske und Komik. Warum?
Die Figuren kämpfen mit großer Anstrengung darum, das Richtige zu tun. Dabei treffen sie andauernd auf alle möglichen Widerstände und scheitern an sich selbst. Darin liegt eine verzweifelte, absurde Komik. Sartre war ja ein großer Fan von Charlie Chaplin und Buster Keaton, bei denen diese Komik auch vorkommt. Das Ende des Stücks wirkt wie ein böser Witz, wenn der Mord, um den so lange so intensiv gerungen wird, plötzlich komplett sinnlos erscheint. Außerdem gibt es viele bewusst komische Dialoge und Slapstick-Nummern. Es geht Sartre auch darum, sein Publikum gut und offensiv zu unterhalten. Daneben hat das Stück insgesamt den Charakter einer zugespitzten Versuchsanordnung. Immer wieder sagen die Figuren, alles sei nur ein Spiel, eine Farce, eine Komödie inmitten von Kulissen. Insofern zielt das Stück nicht auf realistisch-psychologisches Einfühlungstheater, sondern arbeitet bewusst mit Mitteln der Verfremdung. Wir sollen uns nicht sentimental mit den Figuren identifizieren – bei Brecht heißt es: „Glotzt nicht so romantisch!“ – sondern im besten Fall größere existenzielle wie politische Strukturen erkennen; dazu können die Mittel der Überzeichnung beitragen.
Das Stück stammt aus dem Jahr 1948. Inwiefern ist es relevant für unsere Gegenwart?
Durch den aktuellen Krieg und den sich verschärfenden Kampf um die richtige Weltordnung hat es nochmal an Brisanz gewonnen. Aber wir erleben ja auch sonst überall Verhärtungen, Verbitterung, ideologische Verkrampfungen, Polarisierungen und neue Frontstellungen. Das Stück aber ist ein Plädoyer gegen starren Dogmatismus, gegen das Denken in Schablonen und für einen spielerischen, leichteren, lustvollen, fragenden, neugierigen, beweglichen, offenherzigen Umgang mit der Wirklichkeit, ohne dass es die dringlichen politischen Fragen verdrängen würde.
Interview: Christopher Hanf