"Das Persönliche ist politisch - aber anders, als wir denken"
Annalena Küspert und Konstantin Küspert über ihr Stück "Die Mitbürger", das am 27. Januar in der Reithalle uraufgeführt wird
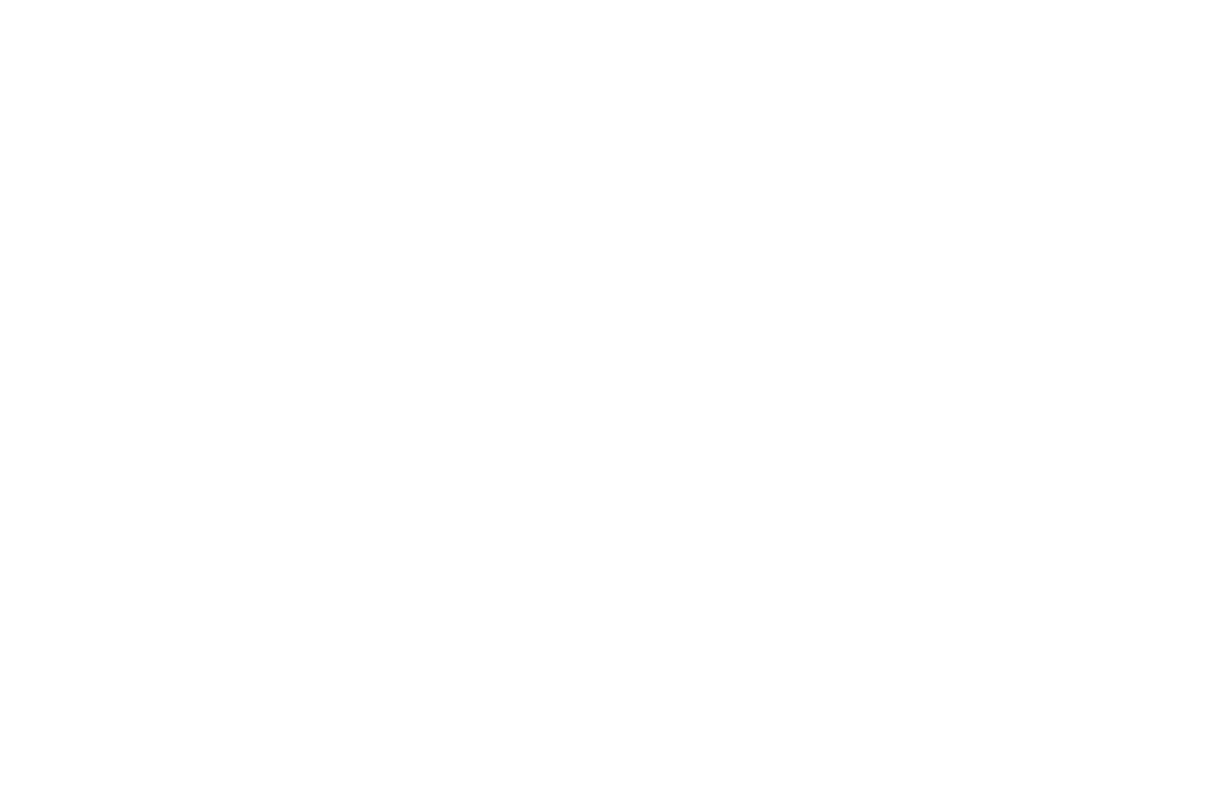
"Die Mitbürger" in Aktion: "Unsere Gesellschaft brennt an allen Ecken und Enden"
Ihr seid beide als Autorin und Autor tätig und behandelt oft hochpolitische Themen. Immer wieder schreibt ihr auch gemeinsam Stücke, so beispielsweise bei „Der Reichsbürger“ (2018) und „Der Bundesbürger“ (2020). Am 27. Januar 2023 kommen „Die Mitbürger“ in Potsdam zur Uraufführung. Gibt es zwischen diesen drei Theatertexten einen Zusammenhang?
Konstantin Küspert: Gesellschaft, ihre (Dys)Funktion und ihre Zersetzungsprozesse sind schon etwas, was uns beschäftigt. Und vielleicht die Frage, wie man eine neue Gesellschaft mündiger Souveräne bauen kann.
Annalena Küspert: Für mich hat in der Arbeit an allen drei Stücken auch immer die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhältnis zur deutschen und deutsch-deutschen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt und die Annahme, dass tabuisierte Emotionen zu unserer Vergangenheit wesentlich dazu beitragen, wie wir uns gesellschaftlich verhalten. Das Persönliche ist politisch, aber vielleicht ein bisschen anders als wir denken. Dieser Blick auf Menschen zieht sich, glaube ich, durch alle drei Arbeiten.
Die „Mitbürger“ sind fünf sehr verschiedene Personen. Was verbindet und was unterscheidet sie?
K. K.: Die Hoffnung nach einer besseren, gerechteren Gesellschaft und eine tiefe Beunruhigung über den Status quo.
A. K.: Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, aber sie sind gleichzeitig gar nicht richtig in der Lage in ein Miteinander zu kommen, weil die eigene individuelle Agenda eben auch an ihnen zerrt. Sie wünschen sich das Gemeinsame, aber nicht um den Preis, Kompromisse machen zu müssen.
Was interessiert euch persönlich am meisten an diesen „Mitbürgern“?
K.K.: Ganz konkret: wie viel davon ist in mir? Wie weit bin ich davon weg bzw. wie nah dran, eigentlich? Die haben die gleichen Fragen wie ich …
A.K.: Das Traurige und Zerbrechliche in den Figuren und ihr permanenter Versuch, das nicht sichtbar werden zu lassen oder nach vorne zu verkaufen. Die Hoffnung beim Arbeiten ist immer, dass es gelingt, dass die Figuren einen glaubhaften Antrieb haben und über ein Klischee hinauskommen. Das war uns schon beim „Reichsbürger“ sehr wichtig und bei den „Mitbürgern“ auch. Fünf sind natürlich viele, da kann man dann einmal die ganze erweiterte Familie durchgehen beim Charaktere ausdenken. Mal gucken, ob die sich erkennen.
Gibt es Impulse aus Politik und Gesellschaft, die ihr aufgegriffen und verarbeitet habt?
K.K.: Es gibt, vermutlich begünstigt durch das Internet, seit einigen Jahren eine deutliche Normalisierung bestimmter unanständiger Narrative, bzw. wird der Raum des Sag- und Denkbaren stetig erweitert. Das finde ich hochinteressant.
A.K.: Mich hat interessiert, was ich schon gerade angerissen habe, dass wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft unser Ego und unsere Individualität so hochhalten, auch total gewohnt sind, unsere Meinung über soziale Plattformen rauszuballern, wo es ja durchaus Widerspruch hageln mag, aber wir uns in unsere Bubble zurückziehen können und auch keine direkte Diskussion in körperlicher Co-Präsenz aushalten müssen; inklusive Unterbrochen-Werden oder Anschreien. Und dann gibt es eine große Sehnsucht nach Gemeinsamkeit und Miteinander von Menschen, die das immer schlechter aushalten können. Das finde ich für die Bühne super lustig, in echt natürlich eher traurig.
Seit Mai letzten Jahres standet ihr in Kontakt mit dem Regieteam um Esther Hattenbach und habt auch die Schauspieler*innen sehr früh kennengelernt. Hat euch das inspiriert? Wenn ja, in welcher Weise?
K.K.: Natürlich! Ein großes Glück, so früh mit dem gesamten Team in Austausch gehen zu können. Die Gedanken der anderen Beteiligten, teilweise ihre persönlichen Geschichten, und besonders im Falle Esthers natürlich auch ihre individuelle Sichtweise auf die Materie haben unser Schreiben sehr beeinflusst.
A.K.: Auf jeden Fall. Es gibt da auch bei mir eine Sehnsucht nach dem Miteinander.
Habt ihr Schauspieler*innen Rollen auf den „Leib“ geschneidert?
K.K.: Das passiert glaube ich automatisch, wenn man weiß, wer besetzt ist, dann stellt man sich die Person in der Szene vor. Ich glaube, dass das möglicherweise die initiale Reibung reduziert.
A.K.: … wobei wir die Kolleg*innen ja nicht persönlich gut kennen. Daher weiß ich nicht, ob “auf den Leib geschneidert”. Aber wir wollen niemanden mit dem, was wir anbieten, ärgern und in die Situation bringen, etwas spielen zu müssen, was einem total zuwider ist. Die Spieler*innen müssen es ja am Ende wuppen und idealerweise mit Freude.
Wie gestaltet es sich konkret, wenn ihr gemeinsam ein Stück schreibt? Welchen Prozess durchlauft ihr mit eurer Grundidee? Habt ihr von Beginn an einen genauen Plan?
A.K.: Ich würde unseren Prozess als im besten Sinne chaotisch beschreiben.
K.K.: Ich nicht. Ich finde, wir sind sehr strukturiert. Dadurch, dass wir, wie es so schön heißt, Tisch und Bett teilen, findet im Alltag ganz viel inhaltliche Synchronisation en passant statt, wir reden oft. Und irgendwann setzen wir uns hin und fangen an zu schreiben, mitunter gleichzeitig, oft zeitlich versetzt, und während dieses Prozesses gibt es natürlich noch Einflüsse in diesem Fall durch unsere Treffen. Einen genauen Plan hatten wir nicht, aber halt schon einige Erfahrung, das gibt Sicherheit.
An dem Abend soll die konventionelle Theatersituation in der Reithalle verändert werden – findet ihr das spannend?
Beide: Ja, sehr spannend!!
K.K.: Das ist die große Alleinstellung des Theaters, dass es in der Lage ist, qua Spieler*innen eine Situation aufzuspannen, der man sich nicht entziehen kann.
A.K.: … eine Immersion, interaktiv und umfassend. Das wird noch viel zu wenig eingesetzt.
Warum ist es wichtig, gerade heute in Deutschland für das Theater zu schreiben?
K.K.: Weil es verdammt nötig ist. Unsere Gesellschaft brennt an allen Ecken.
A.K.: Das wäre wieder das mit dem Persönlichen, das politisch ist, aber anders.
Interview: Bettina Jantzen (erschienen in ZUGABE 01-2023)
Konstantin Küspert: Gesellschaft, ihre (Dys)Funktion und ihre Zersetzungsprozesse sind schon etwas, was uns beschäftigt. Und vielleicht die Frage, wie man eine neue Gesellschaft mündiger Souveräne bauen kann.
Annalena Küspert: Für mich hat in der Arbeit an allen drei Stücken auch immer die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhältnis zur deutschen und deutsch-deutschen Geschichte eine wichtige Rolle gespielt und die Annahme, dass tabuisierte Emotionen zu unserer Vergangenheit wesentlich dazu beitragen, wie wir uns gesellschaftlich verhalten. Das Persönliche ist politisch, aber vielleicht ein bisschen anders als wir denken. Dieser Blick auf Menschen zieht sich, glaube ich, durch alle drei Arbeiten.
Die „Mitbürger“ sind fünf sehr verschiedene Personen. Was verbindet und was unterscheidet sie?
K. K.: Die Hoffnung nach einer besseren, gerechteren Gesellschaft und eine tiefe Beunruhigung über den Status quo.
A. K.: Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, aber sie sind gleichzeitig gar nicht richtig in der Lage in ein Miteinander zu kommen, weil die eigene individuelle Agenda eben auch an ihnen zerrt. Sie wünschen sich das Gemeinsame, aber nicht um den Preis, Kompromisse machen zu müssen.
Was interessiert euch persönlich am meisten an diesen „Mitbürgern“?
K.K.: Ganz konkret: wie viel davon ist in mir? Wie weit bin ich davon weg bzw. wie nah dran, eigentlich? Die haben die gleichen Fragen wie ich …
A.K.: Das Traurige und Zerbrechliche in den Figuren und ihr permanenter Versuch, das nicht sichtbar werden zu lassen oder nach vorne zu verkaufen. Die Hoffnung beim Arbeiten ist immer, dass es gelingt, dass die Figuren einen glaubhaften Antrieb haben und über ein Klischee hinauskommen. Das war uns schon beim „Reichsbürger“ sehr wichtig und bei den „Mitbürgern“ auch. Fünf sind natürlich viele, da kann man dann einmal die ganze erweiterte Familie durchgehen beim Charaktere ausdenken. Mal gucken, ob die sich erkennen.
Gibt es Impulse aus Politik und Gesellschaft, die ihr aufgegriffen und verarbeitet habt?
K.K.: Es gibt, vermutlich begünstigt durch das Internet, seit einigen Jahren eine deutliche Normalisierung bestimmter unanständiger Narrative, bzw. wird der Raum des Sag- und Denkbaren stetig erweitert. Das finde ich hochinteressant.
A.K.: Mich hat interessiert, was ich schon gerade angerissen habe, dass wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft unser Ego und unsere Individualität so hochhalten, auch total gewohnt sind, unsere Meinung über soziale Plattformen rauszuballern, wo es ja durchaus Widerspruch hageln mag, aber wir uns in unsere Bubble zurückziehen können und auch keine direkte Diskussion in körperlicher Co-Präsenz aushalten müssen; inklusive Unterbrochen-Werden oder Anschreien. Und dann gibt es eine große Sehnsucht nach Gemeinsamkeit und Miteinander von Menschen, die das immer schlechter aushalten können. Das finde ich für die Bühne super lustig, in echt natürlich eher traurig.
Seit Mai letzten Jahres standet ihr in Kontakt mit dem Regieteam um Esther Hattenbach und habt auch die Schauspieler*innen sehr früh kennengelernt. Hat euch das inspiriert? Wenn ja, in welcher Weise?
K.K.: Natürlich! Ein großes Glück, so früh mit dem gesamten Team in Austausch gehen zu können. Die Gedanken der anderen Beteiligten, teilweise ihre persönlichen Geschichten, und besonders im Falle Esthers natürlich auch ihre individuelle Sichtweise auf die Materie haben unser Schreiben sehr beeinflusst.
A.K.: Auf jeden Fall. Es gibt da auch bei mir eine Sehnsucht nach dem Miteinander.
Habt ihr Schauspieler*innen Rollen auf den „Leib“ geschneidert?
K.K.: Das passiert glaube ich automatisch, wenn man weiß, wer besetzt ist, dann stellt man sich die Person in der Szene vor. Ich glaube, dass das möglicherweise die initiale Reibung reduziert.
A.K.: … wobei wir die Kolleg*innen ja nicht persönlich gut kennen. Daher weiß ich nicht, ob “auf den Leib geschneidert”. Aber wir wollen niemanden mit dem, was wir anbieten, ärgern und in die Situation bringen, etwas spielen zu müssen, was einem total zuwider ist. Die Spieler*innen müssen es ja am Ende wuppen und idealerweise mit Freude.
Wie gestaltet es sich konkret, wenn ihr gemeinsam ein Stück schreibt? Welchen Prozess durchlauft ihr mit eurer Grundidee? Habt ihr von Beginn an einen genauen Plan?
A.K.: Ich würde unseren Prozess als im besten Sinne chaotisch beschreiben.
K.K.: Ich nicht. Ich finde, wir sind sehr strukturiert. Dadurch, dass wir, wie es so schön heißt, Tisch und Bett teilen, findet im Alltag ganz viel inhaltliche Synchronisation en passant statt, wir reden oft. Und irgendwann setzen wir uns hin und fangen an zu schreiben, mitunter gleichzeitig, oft zeitlich versetzt, und während dieses Prozesses gibt es natürlich noch Einflüsse in diesem Fall durch unsere Treffen. Einen genauen Plan hatten wir nicht, aber halt schon einige Erfahrung, das gibt Sicherheit.
An dem Abend soll die konventionelle Theatersituation in der Reithalle verändert werden – findet ihr das spannend?
Beide: Ja, sehr spannend!!
K.K.: Das ist die große Alleinstellung des Theaters, dass es in der Lage ist, qua Spieler*innen eine Situation aufzuspannen, der man sich nicht entziehen kann.
A.K.: … eine Immersion, interaktiv und umfassend. Das wird noch viel zu wenig eingesetzt.
Warum ist es wichtig, gerade heute in Deutschland für das Theater zu schreiben?
K.K.: Weil es verdammt nötig ist. Unsere Gesellschaft brennt an allen Ecken.
A.K.: Das wäre wieder das mit dem Persönlichen, das politisch ist, aber anders.
Interview: Bettina Jantzen (erschienen in ZUGABE 01-2023)