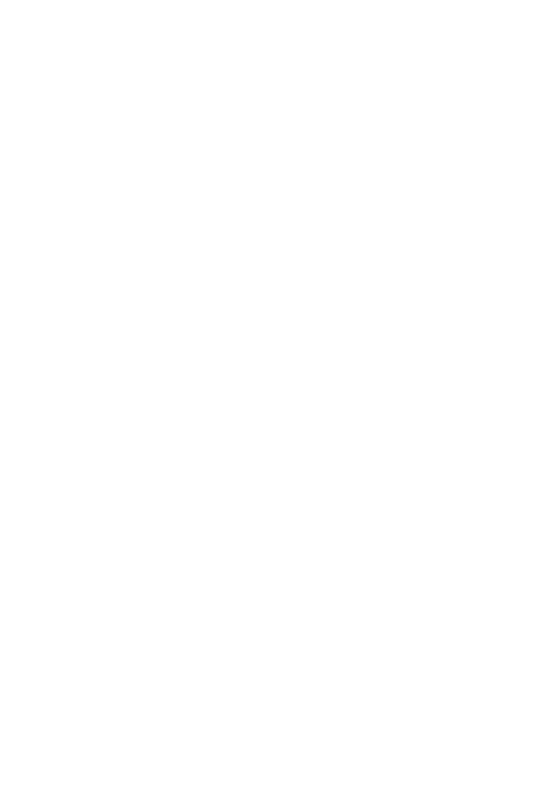JEDES DING ERSCHEINT DANN IN EINEM NEUEN LICHT
Als „Harold und Maude“ 1971 in die Kinos kam, fiel der Film zunächst bei Publikum und Kritik durch. „Gruselig und abstoßend“, urteilte die New York Times über die beiden Hauptfiguren, obwohl angesagte Leute aus dem Filmgeschäft an der Produktion beteiligt gewesen waren: Regie hatte Hal Ashby geführt, der als aufstrebender Regisseur des ‚New Hollywood‘ galt. Die Schauspielerin Ruth Gordon (Maude) hatte gerade für ihre teuflisch böse Rolle in „Rosemaries Baby“ einen Oscar als Beste Nebendarstellerin erhalten und der noch sehr junge Schauspieler Bud Cort (Harold) eine Hauptrolle bei Robert Altman gespielt.
Die zunächst zurückhaltenden Reaktionen auf den Film – bevor er später Kult wurde – haben vielleicht damit zu tun, dass „Harold und Maude“ offensiv mit auch heute noch tabuisierten Themen wie selbstbestimmtes Sterben oder Sexualität im Alter (zumal mit einem sehr viel jüngeren Partner) spielt. Auf irritierend schräge wie komische Weise bildet der Tod den Rahmen und das Hauptmotiv der Handlung. Zwar knüpft der Film an die Hippie-Kultur der späten 60er Jahre an, indem er Lebensfreude und Selbstverwirklichung feiert und sich mittels der typenhaft-witzigen Darstellung der gesellschaftlichen Ordnungsträger gegen Statusdenken und bürgerliche Konventionen wendet. Durch den permanent präsenten Horizont des Todes erscheinen diese Elemente der 68er-Weltanschauung aber in ungewöhnlichem Licht.
Kultur- und literaturgeschichtlich ist die Vergegenwärtigung der Dimension des Todes ein uraltes, wiederkehrendes Motiv, das häufig mit der Einsicht in die Vergänglichkeit aller Dinge („Vanitas“) verbunden ist. Eine mögliche Reaktion auf diese Einsicht ist die Weltverachtung („Contemptus Mundi“) – eine Haltung, mit der sich auch Harold identifizieren kann. Seiner inneren Rebellion gegen die Gesellschaft, repräsentiert durch seine Mutter, verleiht er in Form nekrophiler Zerstörungs-Performances Ausdruck. Den Erwartungen an junge Menschen – Vitalität, Lebensfreude, Hoffnung – verweigert er sich, indem er mittels seiner morbiden Scherze eine Art destruktiven Anarchismus praktiziert und sich in seiner „Schwarze Romantik“-Kugel abkapselt, fast wie ein Vorfahr der Punk- oder Gothic-Bewegung.
Eine kulturgeschichtlich zweite, ganz andere Möglichkeit, auf die „Vanitas“-Einsicht zu reagieren, ist die „Carpe-Diem“-Haltung, die Bereitschaft also, sich ganz dem Augenblick zu widmen. Hier kommt Maude ins Spiel. Sie weiß um die Vergänglichkeit aller Dinge – „Auch dies wird verlorengehen“, lautet ihr Leitspruch – aber gerade daraus gewinnt sie eine ungeheure Lebensenergie. Besitz und Status bedeuten ihr nichts. Sie nimmt sich selbst nicht so wichtig und kann sich ganz dem hingeben, was ihr im Moment begegnet. Sie ist frei zu lieben. Mit sinnenfroher, kindlicher Entdeckerlust und radikaler Offenherzigkeit geht sie auf die Menschen und Dinge zu, interessiert sie sich ohne Vorurteile für jedes Detail des Lebens.
Als ihre Wohnungseinrichtung von der Polizei gepfändet und verwüstet wird, kann sie auch darin etwas Positives sehen: „Ich finde es ganz schön, wenn alles so zwanglos arrangiert ist. Jedes Ding erscheint dann in einem neuen Licht.“ Mit dieser Fähigkeit, die gewohnten Wahrnehmungsmuster zu verlassen und alles mit anderen Augen zu betrachten, erweist sie sich als (Lebens-) Künstlerin. Auf die restliche Gesellschaft, in der beständig Grenzen gezogen werden, in der Eigentumsdenken und festgefügte Formen der Weltdeutung vorherrschen, wirkt eine Gestalt wie Maude in höchstem Maße irritierend.
Die alle Konventionen sprengende, scheinbar unmögliche Liebe zwischen dem vermeintlich so ungleichen Paar sorgt für entsetze Abwehr unter den Vertretern des Status Quo – was wiederum eine schräge Komik entstehen lässt. Liebe, Tod und Witz sind Kräfte mit subversivem Potenzial, die zementierte Mauern einreißen und Brücken bauen können.
Christopher Hanf
Die zunächst zurückhaltenden Reaktionen auf den Film – bevor er später Kult wurde – haben vielleicht damit zu tun, dass „Harold und Maude“ offensiv mit auch heute noch tabuisierten Themen wie selbstbestimmtes Sterben oder Sexualität im Alter (zumal mit einem sehr viel jüngeren Partner) spielt. Auf irritierend schräge wie komische Weise bildet der Tod den Rahmen und das Hauptmotiv der Handlung. Zwar knüpft der Film an die Hippie-Kultur der späten 60er Jahre an, indem er Lebensfreude und Selbstverwirklichung feiert und sich mittels der typenhaft-witzigen Darstellung der gesellschaftlichen Ordnungsträger gegen Statusdenken und bürgerliche Konventionen wendet. Durch den permanent präsenten Horizont des Todes erscheinen diese Elemente der 68er-Weltanschauung aber in ungewöhnlichem Licht.
Kultur- und literaturgeschichtlich ist die Vergegenwärtigung der Dimension des Todes ein uraltes, wiederkehrendes Motiv, das häufig mit der Einsicht in die Vergänglichkeit aller Dinge („Vanitas“) verbunden ist. Eine mögliche Reaktion auf diese Einsicht ist die Weltverachtung („Contemptus Mundi“) – eine Haltung, mit der sich auch Harold identifizieren kann. Seiner inneren Rebellion gegen die Gesellschaft, repräsentiert durch seine Mutter, verleiht er in Form nekrophiler Zerstörungs-Performances Ausdruck. Den Erwartungen an junge Menschen – Vitalität, Lebensfreude, Hoffnung – verweigert er sich, indem er mittels seiner morbiden Scherze eine Art destruktiven Anarchismus praktiziert und sich in seiner „Schwarze Romantik“-Kugel abkapselt, fast wie ein Vorfahr der Punk- oder Gothic-Bewegung.
Eine kulturgeschichtlich zweite, ganz andere Möglichkeit, auf die „Vanitas“-Einsicht zu reagieren, ist die „Carpe-Diem“-Haltung, die Bereitschaft also, sich ganz dem Augenblick zu widmen. Hier kommt Maude ins Spiel. Sie weiß um die Vergänglichkeit aller Dinge – „Auch dies wird verlorengehen“, lautet ihr Leitspruch – aber gerade daraus gewinnt sie eine ungeheure Lebensenergie. Besitz und Status bedeuten ihr nichts. Sie nimmt sich selbst nicht so wichtig und kann sich ganz dem hingeben, was ihr im Moment begegnet. Sie ist frei zu lieben. Mit sinnenfroher, kindlicher Entdeckerlust und radikaler Offenherzigkeit geht sie auf die Menschen und Dinge zu, interessiert sie sich ohne Vorurteile für jedes Detail des Lebens.
Als ihre Wohnungseinrichtung von der Polizei gepfändet und verwüstet wird, kann sie auch darin etwas Positives sehen: „Ich finde es ganz schön, wenn alles so zwanglos arrangiert ist. Jedes Ding erscheint dann in einem neuen Licht.“ Mit dieser Fähigkeit, die gewohnten Wahrnehmungsmuster zu verlassen und alles mit anderen Augen zu betrachten, erweist sie sich als (Lebens-) Künstlerin. Auf die restliche Gesellschaft, in der beständig Grenzen gezogen werden, in der Eigentumsdenken und festgefügte Formen der Weltdeutung vorherrschen, wirkt eine Gestalt wie Maude in höchstem Maße irritierend.
Die alle Konventionen sprengende, scheinbar unmögliche Liebe zwischen dem vermeintlich so ungleichen Paar sorgt für entsetze Abwehr unter den Vertretern des Status Quo – was wiederum eine schräge Komik entstehen lässt. Liebe, Tod und Witz sind Kräfte mit subversivem Potenzial, die zementierte Mauern einreißen und Brücken bauen können.
Christopher Hanf
"Den Moment meinen und leben": Rita Feldmeier über die Rolle der Maude
Maude ist eine tolle Figur. Sie lebt so viel vor: Liebe, Toleranz, Gelassenheit, Weitsicht, Neugier, Schmerz. Sie setzt ihre Visionen mit Kraft und Entschlossenheit um. Sie versucht, die Leute sanft darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich irren. Man kann sich dieser Frau schwer entziehen.
Ebenfalls ganz spannend ist das Miteinander der Figuren. Wichtig sind ganz direkte Gedankengänge der Figurensuche, eine große Leidenschaft und Ehrlichkeit. Den Moment meinen und leben ist auch eine Qualität der Maude – und die Verzweiflung über so viel Dummheit und Sinnlosigkeit auf dieser Welt.
Was für ein Glück für Harold, dass er sie trifft! Man möchte jedem Menschen solch eine Begegnung wünschen, die ihm die Augen öffnet und ihn lehrt, das Herz sprechen zu lassen, zu vertrauen und achtsam mit sich und anderen zu sein.
Ich werde persönlich viel aus dieser Arbeit mitnehmen, da bin ich mir sicher. Was für ein Glück, sich mit diesem Stück beschäftigen zu dürfen!
Ebenfalls ganz spannend ist das Miteinander der Figuren. Wichtig sind ganz direkte Gedankengänge der Figurensuche, eine große Leidenschaft und Ehrlichkeit. Den Moment meinen und leben ist auch eine Qualität der Maude – und die Verzweiflung über so viel Dummheit und Sinnlosigkeit auf dieser Welt.
Was für ein Glück für Harold, dass er sie trifft! Man möchte jedem Menschen solch eine Begegnung wünschen, die ihm die Augen öffnet und ihn lehrt, das Herz sprechen zu lassen, zu vertrauen und achtsam mit sich und anderen zu sein.
Ich werde persönlich viel aus dieser Arbeit mitnehmen, da bin ich mir sicher. Was für ein Glück, sich mit diesem Stück beschäftigen zu dürfen!
"Eine großartige, sinnliche Geschichte"
Rita Feldmeier hat zwei Drittel ihres Lebens am Hans Otto Theater verbracht. Am Ende dieser Spielzeit hört sie auf – nach 44 Jahren. Ein Gespräch über kleine und große Rollen, weibliche Führungsqualitäten und ihre aktuelle Produktion "Harold und Maude".
Du bist seit über vier Jahrzehnten am Hans Otto Theater engagiert –
eine beeindruckende Zeitspanne: Wie schafft man das?
Rita Feldmeier: Eine so lange Zeit an einem Theater arbeiten zu dürfen,
ist ein Geschenk und keine Frage des „Schaffens“. Ich genieße seit der
Wende das Privileg, unkündbar zu sein. Ich wusste immer: Hier ist mein
Zuhause, ich brauche nicht von einer Stadt in die andere zu hetzen,
kann in Ruhe Familie leben und mich auf meine Arbeit konzentrieren,
ohne Existenzängste.
Du stammst aus Rostock, deine Eltern leben noch heute dort. Kannst du dich an deine Anfänge am Volkstheater erinnern?
Auf der Schauspielschule in Rostock wusste ich bereits ab dem 2. Studienjahr, dass ich an das dortige Volkstheater engagiert werde. Ich habe schon während des Studiums und die drei Jahre danach viele große Rollen spielen dürfen. Ich konnte mich frei spielen, naiv und voller Lust. Das war wichtig und hat mir gut getan.
Wie hat es dich dann nach Potsdam verschlagen?
Ich wollte aus Rostock weg, um erwachsen zu werden. Potsdam bot mir zwar 100 Mark weniger an, aber das Theater hatte in der Republik einen besonders guten Ruf. Hier erst habe ich begriffen, was der Beruf bedeutet, und gelernt, eine Rolle bewusst zu erarbeiten.
Als junge Schauspielerin musstest du dich lange mit kleinen Rollen begnügen. Hat das an deinem Selbstbewusstsein genagt?
Das kann man so nicht sagen. Alles muss gespielt werden, und kleinere Rollen sind nicht zwangsläufig leichtere Rollen. Ich hätte immer gern mehr gespielt, doch zur damaligen Zeit hat das Schauspiel nur acht Produktionen in einer Spielzeit erarbeitet. Was bleibt da? Außerdem gab es ein sehr starkes und selbstbewusstes Ensemble, das bekam ich zu spüren und musste mich erst einmal beweisen. Das war nicht immer einfach, und ich war auch mal kurz davor, den Beruf aufzugeben.
Wie hast du diese Krise überstanden?
Indem ich gelernt habe, mich zu wehren.
Wie alt warst du da?
Das ist natürlich ein Prozess. Grob gesagt, musste ich erst 50 werden. Ich habe irgendwann begriffen, wenn man sich wehrt, einen Standpunkt hat, auch mal nein sagt, wird man anders akzeptiert und wahrgenommen. Ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, aber nicht mehr um jeden Preis.
Welches war deine künstlerisch fruchtbarste Zeit an diesem Haus?
Die Zeit der Intendanz von Ralf-Günter Krolkiewicz. Er hat mich gezielt gefördert, mir mehr zugetraut als ich mir selber. Was für ein Glück, mit so einem Vertrauen arbeiten zu dürfen.
Gab es einen Moment, den man deinen Durchbruch nennen könnte?
Nein, es gab für mich am Theater immer bessere oder schlechtere Zeiten. Das ist normal. Während der Wende hatte ich allerdings zwei Hauptrollen bei der DEFA; das hätte mir weiterhin gefallen, aber das hatte sich ja dann erledigt.
Welche Rollen bleiben dir für immer im Gedächtnis?
Wo fange ich an? Es sind zu viele!
Du bist im Drama zu Hause, aber auch in der Revue – als Elisabeth in „Maria Stuart“ ebenso wie als „Marlene“ oder „Lola Blau“, auch die Sally in „Cabaret“ hast du mal gespielt. Für welche Art Theater schlägt dein Herz besonders?
Für alles! Ich liebe die Abwechslung. Allerdings brauche ich für das jeweilige Genre das richtige Team um mich herum. Ohne gute Partner vor, hinter oder auf der Bühne kann man es zu keiner besonderen Leistung bringen. Teamarbeit ist wunderbar, wenn es aber nicht klappt, leider zum Verzweifeln.
Du hast sechs Intendanten erlebt und jetzt mit Bettina Jahnke erstmals eine Intendantin. Macht sie etwas anders als ihre Herren Vorgänger?
Die Gegensätzlichkeit der Geschlechter ist wichtig und gut. Aber Frauen haben oft andere Denkansätze, das macht sich natürlich auch im Leitungsstil bemerkbar. Bettina Jahnke hat eine wahnsinnig ansteckende Energie, das ist neu und tut gut. Überhaupt finde ich unsere ganze Frauenriege in der „oberen Etage“ super – klare Ansagen, Zuhören und Herzlichkeit. So empfinde ich das als Spielende.
Nach „Occident Express“ in der vergangenen Spielzeit wirst du ab November in „Harold und Maude“ erneut eine Hauptrolle spielen – an der Seite des 39 Jahre jüngeren Kollegen David Hörning. Wie siehst du dieser Arbeit entgegen?
Mit Freude und Respekt! Apropos „Occident Express“ – das gehört wirklich in die Reihe meiner härtesten und schönsten Herausforderungen.
Das Stück ist in Potsdam nicht mehr zu sehen, du wirst es aber noch einmal spielen – am 13. November in Stuttgart, auf Einladung des Festivals Made in Germany.
Genau, das wird sehr spannend!
Zurück zu „Harold und Maude“ …
Vor etlichen Jahren habe ich den Film gesehen, und die Geschichte ist mir haften geblieben. Mir ist auch noch die berührende Inszenierung 2002 von Günter Rüger mit Gertraud Kreißig und David Emig in Erinnerung. Ich weiß sogar noch, wo ich in der Blechbüchse gesessen habe. Ich habe gelacht, und es kullerten auch Tränen. Eine großartige, sinnliche Geschichte. Ein wunderbares Geschenk für meine letzte Spielzeit in Potsdam.
Wie siehst du deine Figur?
Maude ist eine tolle Frau. Sie lebt so viel vor. Liebe, Gelassenheit, Weitsicht, Neugier, Schmerz. Den Moment meinen und leben. Sie setzt ihre Visionen konsequent um, öffnet Augen, lehrt Menschen, das Herz sprechen zu lassen, zu vertrauen, achtsam zu sein. Ich werde mit Sicherheit auch persönlich viel aus dieser Arbeit mitnehmen.
Wenn man dich im Theateralltag erlebt, dann verströmst du oft eine geradezu jungmädchenhafte Energie. Wo nimmst du die her? Was hält dich jung?
Die Arbeit, das Zusammensein mit jungen Leuten, Neugier auf Unbekanntes, Freude an Bewegung – und das Allerwichtigste: Familie leben. Das macht mich zufrieden und glücklich und gibt mir Kraft.
Interview: Björn Achenbach
eine beeindruckende Zeitspanne: Wie schafft man das?
Rita Feldmeier: Eine so lange Zeit an einem Theater arbeiten zu dürfen,
ist ein Geschenk und keine Frage des „Schaffens“. Ich genieße seit der
Wende das Privileg, unkündbar zu sein. Ich wusste immer: Hier ist mein
Zuhause, ich brauche nicht von einer Stadt in die andere zu hetzen,
kann in Ruhe Familie leben und mich auf meine Arbeit konzentrieren,
ohne Existenzängste.
Du stammst aus Rostock, deine Eltern leben noch heute dort. Kannst du dich an deine Anfänge am Volkstheater erinnern?
Auf der Schauspielschule in Rostock wusste ich bereits ab dem 2. Studienjahr, dass ich an das dortige Volkstheater engagiert werde. Ich habe schon während des Studiums und die drei Jahre danach viele große Rollen spielen dürfen. Ich konnte mich frei spielen, naiv und voller Lust. Das war wichtig und hat mir gut getan.
Wie hat es dich dann nach Potsdam verschlagen?
Ich wollte aus Rostock weg, um erwachsen zu werden. Potsdam bot mir zwar 100 Mark weniger an, aber das Theater hatte in der Republik einen besonders guten Ruf. Hier erst habe ich begriffen, was der Beruf bedeutet, und gelernt, eine Rolle bewusst zu erarbeiten.
Als junge Schauspielerin musstest du dich lange mit kleinen Rollen begnügen. Hat das an deinem Selbstbewusstsein genagt?
Das kann man so nicht sagen. Alles muss gespielt werden, und kleinere Rollen sind nicht zwangsläufig leichtere Rollen. Ich hätte immer gern mehr gespielt, doch zur damaligen Zeit hat das Schauspiel nur acht Produktionen in einer Spielzeit erarbeitet. Was bleibt da? Außerdem gab es ein sehr starkes und selbstbewusstes Ensemble, das bekam ich zu spüren und musste mich erst einmal beweisen. Das war nicht immer einfach, und ich war auch mal kurz davor, den Beruf aufzugeben.
Wie hast du diese Krise überstanden?
Indem ich gelernt habe, mich zu wehren.
Wie alt warst du da?
Das ist natürlich ein Prozess. Grob gesagt, musste ich erst 50 werden. Ich habe irgendwann begriffen, wenn man sich wehrt, einen Standpunkt hat, auch mal nein sagt, wird man anders akzeptiert und wahrgenommen. Ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, aber nicht mehr um jeden Preis.
Welches war deine künstlerisch fruchtbarste Zeit an diesem Haus?
Die Zeit der Intendanz von Ralf-Günter Krolkiewicz. Er hat mich gezielt gefördert, mir mehr zugetraut als ich mir selber. Was für ein Glück, mit so einem Vertrauen arbeiten zu dürfen.
Gab es einen Moment, den man deinen Durchbruch nennen könnte?
Nein, es gab für mich am Theater immer bessere oder schlechtere Zeiten. Das ist normal. Während der Wende hatte ich allerdings zwei Hauptrollen bei der DEFA; das hätte mir weiterhin gefallen, aber das hatte sich ja dann erledigt.
Welche Rollen bleiben dir für immer im Gedächtnis?
Wo fange ich an? Es sind zu viele!
Du bist im Drama zu Hause, aber auch in der Revue – als Elisabeth in „Maria Stuart“ ebenso wie als „Marlene“ oder „Lola Blau“, auch die Sally in „Cabaret“ hast du mal gespielt. Für welche Art Theater schlägt dein Herz besonders?
Für alles! Ich liebe die Abwechslung. Allerdings brauche ich für das jeweilige Genre das richtige Team um mich herum. Ohne gute Partner vor, hinter oder auf der Bühne kann man es zu keiner besonderen Leistung bringen. Teamarbeit ist wunderbar, wenn es aber nicht klappt, leider zum Verzweifeln.
Du hast sechs Intendanten erlebt und jetzt mit Bettina Jahnke erstmals eine Intendantin. Macht sie etwas anders als ihre Herren Vorgänger?
Die Gegensätzlichkeit der Geschlechter ist wichtig und gut. Aber Frauen haben oft andere Denkansätze, das macht sich natürlich auch im Leitungsstil bemerkbar. Bettina Jahnke hat eine wahnsinnig ansteckende Energie, das ist neu und tut gut. Überhaupt finde ich unsere ganze Frauenriege in der „oberen Etage“ super – klare Ansagen, Zuhören und Herzlichkeit. So empfinde ich das als Spielende.
Nach „Occident Express“ in der vergangenen Spielzeit wirst du ab November in „Harold und Maude“ erneut eine Hauptrolle spielen – an der Seite des 39 Jahre jüngeren Kollegen David Hörning. Wie siehst du dieser Arbeit entgegen?
Mit Freude und Respekt! Apropos „Occident Express“ – das gehört wirklich in die Reihe meiner härtesten und schönsten Herausforderungen.
Das Stück ist in Potsdam nicht mehr zu sehen, du wirst es aber noch einmal spielen – am 13. November in Stuttgart, auf Einladung des Festivals Made in Germany.
Genau, das wird sehr spannend!
Zurück zu „Harold und Maude“ …
Vor etlichen Jahren habe ich den Film gesehen, und die Geschichte ist mir haften geblieben. Mir ist auch noch die berührende Inszenierung 2002 von Günter Rüger mit Gertraud Kreißig und David Emig in Erinnerung. Ich weiß sogar noch, wo ich in der Blechbüchse gesessen habe. Ich habe gelacht, und es kullerten auch Tränen. Eine großartige, sinnliche Geschichte. Ein wunderbares Geschenk für meine letzte Spielzeit in Potsdam.
Wie siehst du deine Figur?
Maude ist eine tolle Frau. Sie lebt so viel vor. Liebe, Gelassenheit, Weitsicht, Neugier, Schmerz. Den Moment meinen und leben. Sie setzt ihre Visionen konsequent um, öffnet Augen, lehrt Menschen, das Herz sprechen zu lassen, zu vertrauen, achtsam zu sein. Ich werde mit Sicherheit auch persönlich viel aus dieser Arbeit mitnehmen.
Wenn man dich im Theateralltag erlebt, dann verströmst du oft eine geradezu jungmädchenhafte Energie. Wo nimmst du die her? Was hält dich jung?
Die Arbeit, das Zusammensein mit jungen Leuten, Neugier auf Unbekanntes, Freude an Bewegung – und das Allerwichtigste: Familie leben. Das macht mich zufrieden und glücklich und gibt mir Kraft.
Interview: Björn Achenbach